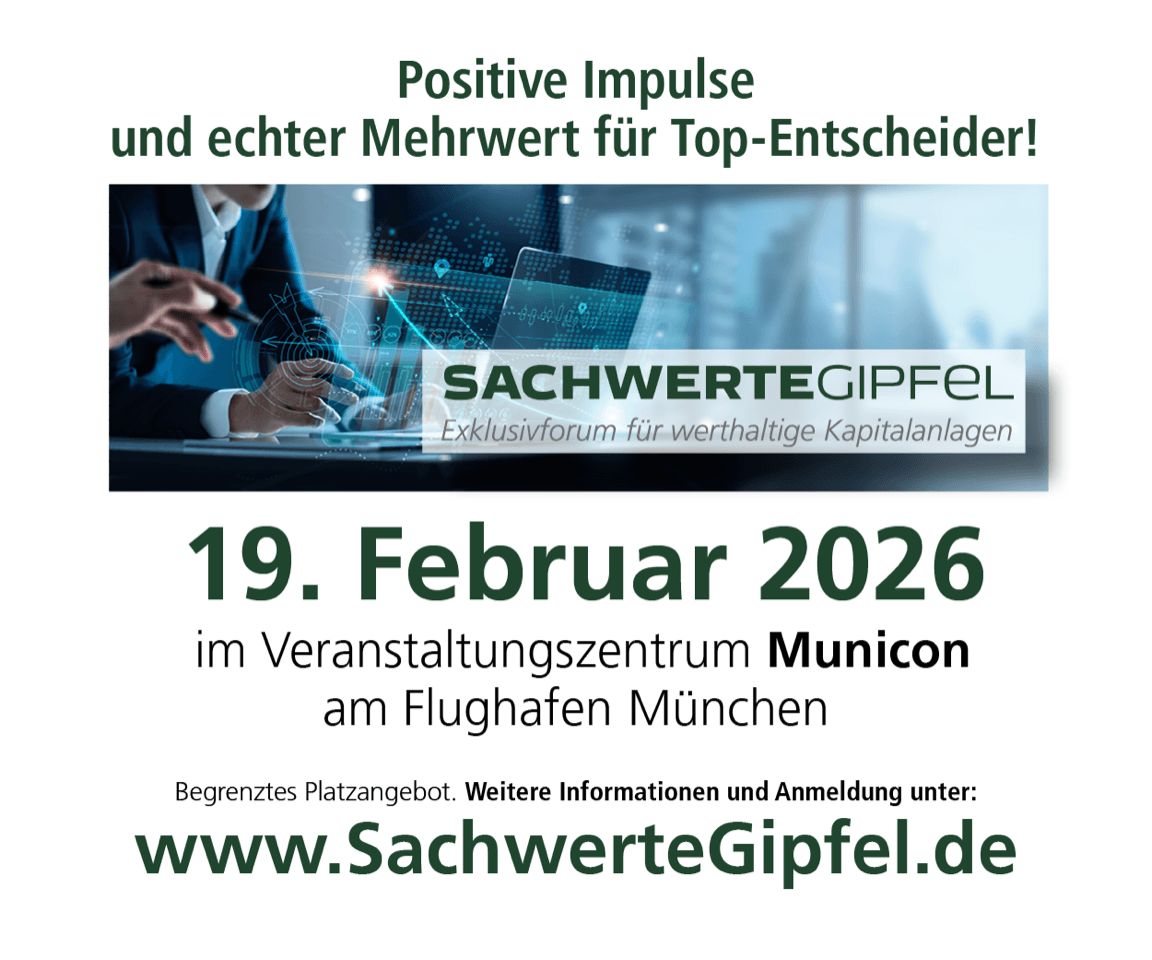Definition, Risiken und Versicherungslösungen für eine komplexe Branche
17.10.2025

Foto: © TensorSpark - stock.adobe.com
Banken, Versicherer, Fonds oder FinTechs – der Begriff Financial Institutions (FI) umfasst eine Vielzahl von Akteuren. Doch eine einheitliche Definition fehlt, und gerade daraus erwachsen Herausforderungen für Regulierung, Risikomanagement und Versicherungsschutz. Dieser Artikel beleuchtet, wer zur FI-Branche gezählt werden kann, welchen spezifischen Haftungsrisiken die Unternehmen und ihre Entscheidungsträger ausgesetzt sind und welche Ansätze für einen maßgeschneiderten Risikotransfer existieren.
Was macht ein Unternehmen zur „Financial Institution“?
So selbstverständlich der Begriff Financial Institution klingt – eine gesetzlich verankerte Definition gibt es nicht. In der gängigen Praxis umfasst er Unternehmen, die mit den Geldern Dritter arbeiten oder Investoreninteressen vertreten. Etwa:
- Kredit- und Finanzinstitute wie z. B. Banken, Factoringund Leasinggesellschaften
- Versicherungen, darunter private Versicherungsunternehmen sowie gesetzliche Krankenkassen
- Kapitalmarktakteure bestehend aus Fonds, Asset Manager, Private Equity- oder Venture-Capital-Gesellschaften, Family Offices, etc.
- Neue Player: FinTechs und InsurTechs, die mit digitalen Lösungen Finanz- oder Versicherungsdienstleistungen anbieten
Für Versicherer, Makler und Vertriebe ist aber eine klare Definition unerlässlich: Nur so lassen sich passgenaue Versicherungsprodukte entwickeln, Underwriting-Prozesse sinnvoll steuern und Mandanten professionell beraten. Ein praktikabler Ansatz ist daher, Unternehmen als Finanzdienstleister zu betrachten, wenn sie entweder der BaFin-Aufsicht unterliegen, die Interessen von Investoren in den Mittelpunkt stellen oder überwiegend mit fremden Mitteln arbeiten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Vermittler nach Gewerbeordnung oder Einrichtungen wie Versorgungswerke oder Stiftungen, deren Zweck nicht primär auf Gewinnerzielung oder Kapitalanlage gerichtet ist, meist nicht darunter fallen.
Risiken der FI-Branche – mehr als nur „finanzielle Turbulenzen“
FI-Unternehmen sind darauf angewiesen, dass Kunden ihnen Vertrauen und Verantwortung im Umgang mit Kapital unterstellen. Fehler und Pflichtverletzungen, die bekannt werden, können daher existenzielle Folgen haben – nicht nur für die Reputation. Beispielsweise:
- Haftung für Beratungs- und Anlagefehler
Ein Family Office oder Vermögensverwalter, die riskante Investments empfehlen, können schnell mit hohen Schadensersatzforderungen konfrontiert werden. Gleiches gilt auch für Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG), welche bei schuldhafter Verletzung von Treueund Sorgfaltspflichten und daraus resultierenden Vermögensschäden gegenüber Fonds/Anlegern haften.
- Managerhaftung
Geschäftsleiter von Banken oder Versicherungen haften persönlich – unabhängig von der Haftung des Unternehmens. Der Fall Wirecard hat gezeigt, wie weitreichend persönliche Konsequenzen sein können.
- Regulatorische Risiken
Finanzinstitute stehen unter ständiger Aufsicht. Verstöße gegen Meldepflichten oder Geldwäschevorschriften ziehen Strafen und/oder Reputationsschäden nach sich.
- Technologische Risiken
FinTechs und InsurTechs sind durch die Digitalisierung vermehrt Cyberangriffen ausgesetzt oder von Systemausfällen betroffen.
- Vertragliche Besonderheiten
Verträge können pauschalierte Schadensersatzleistungen enthalten oder gar eine verschuldensunabhängige Haftung. Da kann ein Fehler hohe Schadenssummen auslösen.
Eine fundierte Risikoanalyse ist angeraten. Dabei werden Tätigkeiten und Verantwortlichkeiten systematisch in einer Matrix erfasst und mit Haftungsrisiken bewertet, die sowohl das Unternehmen betreffen als auch das Management.
Versicherungsschutz als zentrales Element des Risikotransfers
Sind Haftungsrisiken identifiziert, stellt sich als nächstes die Frage: Welche Risiken sollen versichert werden – und in welcher Höhe? In der FI-Branche sind insbesondere drei Produktformen entscheidend:
- D&O-Versicherung (Directors & Officers): Schutz für Organe und Manager vor persönlicher Inanspruchnahme
- E&O-Versicherung (Errors & Omissions): Absicherung des Unternehmens selbst (und seiner Mitarbeiter) gegen Haftpflichtansprüche aus Vermögensschäden
- Kombinationslösungen D&O/E&O: Häufig mit geteilter Versicherungssumme, um Synergieeffekte zu nutzen
Achtung bei der Auswahl
Versicherungssummen sollten in mehreren Varianten angefragt werden, da höhere Limits nicht zwingend proportional teurer sind. In der E&O sind Selbstbehalte üblich, in der D&O meist nicht. Besonders wichtig ist, dass Versicherer über eigene Spezialisten im Underwriting und in der Schadenbearbeitung verfügen. Nur so lässt sich im Ernstfall schnell und sachkundig reagieren.
Fazit
Ohne Spezialisten geht es nicht. Finanzdienstleister (Financial Institutions) sind eine heterogene und hochspezialisierte Branche. Deren Tätigkeiten bergen spezifische Haftungsrisiken, die eines professionellen Risikomanagements bedürfen. D&O- und E&O-Deckungen sind zentrale Bausteine der Absicherung. Wer als Unternehmen oder Manager in diesem Segment tätig ist, sollte den Dialog mit Spezialversicherern und erfahrenen Maklern suchen.
Ein Beitrag von Mario Hartmann, Product Lead W&I, PI und E&O Tailormade Solutions, Markel Insurance SE

Banking für Berater und Quereinsteiger (Online-Seminar, 2+1 Tage) – Kompakt, praxisnah, verständlich – 24.-25. + 27. Februar 2026