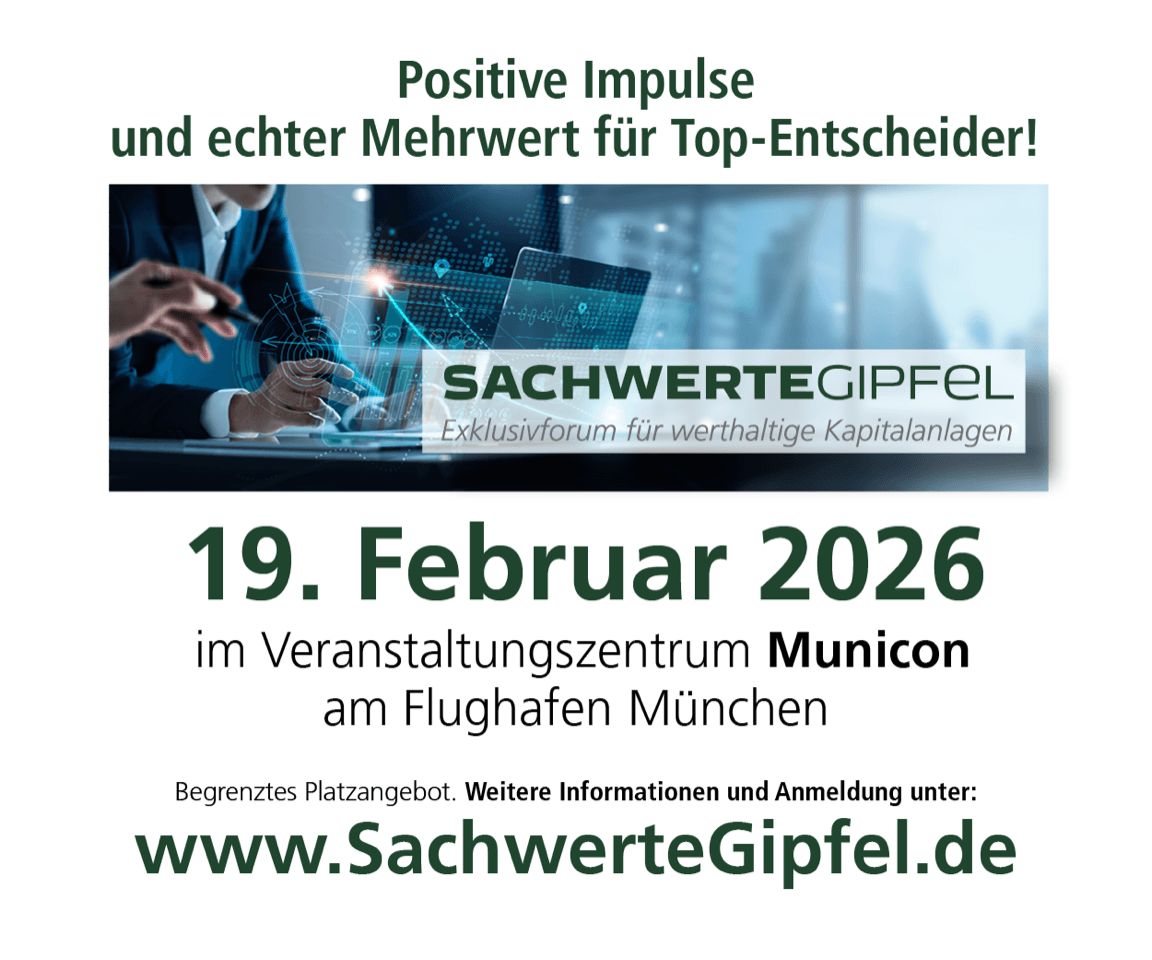Steigende Schäden durch Naturkatastrophen: Vier Risikofaktoren
12.11.2025

Foto: © mb67 - stock.adobe.com
Der Klimawandel verändert das globale Risikoprofil: Extremwetterereignisse und Naturkatastrophen (NatCat) zählen zu den größten wirtschaftlichen Risiken weltweit. Schadenssummen steigen kontinuierlich und die Versicherungsdurchdringung in besonders gefährdeten Regionen ist oft gering. Um Risiken wirksam zu begegnen und ihren Kunden als verlässlicher Partner in Transformation zur Seite zu stehen, müssen Versicherer aktiv sein und sich strategisch einbringen.
Dr. Melanie Fischer, Natural Hazards und GIS/Data Analystin bei HDI Global, zeigt die Risikofaktoren rund um NatCat-Ereignisse auf und erläutert, wie Versicherer die Resilienz ihrer Partner gegenüber Klimarisiken erhöhen können.
1. Sozioökonomische Faktoren bestimmen Schadenstrends
Sozioökonomische Prozesse sind der Haupttreiber für den Anstieg versicherter NatCat-Schäden. Bevölkerungswachstum, zunehmender Wohlstand und rasante Urbanisierung führen dazu, dass immer mehr wertvolle Güter in gefährdeten Regionen konzentriert sind. Dadurch steigt die Exponierung gegenüber Naturgefahren. Zusätzlich treiben steigende Baukosten, Arbeitskräftemangel und Lieferengpässe die Wiederaufbaukosten nach Naturkatastrophen weiter in die Höhe.
Die Folgen reichen weit über einzelne Unternehmen oder Haushalte hinaus. Naturkatastrophen können die wirtschaftliche Entwicklung ganzer Regionen erheblich beeinträchtigen, Arbeitsplätze bedrohen und die lokale Infrastruktur nachhaltig schwächen. In Ländern mit geringer Versicherungsdurchdringung verschärfen sich dadurch soziale Disparitäten.
2. Secondary Perils prägen das Risikoprofil
Historisch gesehen sind die größten NatCat-Verluste auf tropische Wirbelstürme und Erdbeben, wie Hurrikan Katrina (2005) und das Tohoku-Erdbeben in Japan (2011), zurückzuführen. Solche „Primary Perils“ treten grundsätzlich selten auf, verursachen aber gravierende Schäden mit erheblichen humanitären und gesellschaftlichen Folgen. Demgegenüber stehen „Secondary Perils“ wie Überschwemmungen, Waldbrände oder schwere konvektive Stürme. Sie führen meist zu kleineren Einzelschäden, treten jedoch häufiger auf. Ihre kumulierte Wirkung ist erheblich: Im Jahr 2024 machten Sekundärgefahren mehr als die Hälfte der weltweit versicherten NatCat-Schäden aus – ein deutliches Zeichen für ihre wachsende Bedeutung im Risikomanagement.
3. Anthropogener Klimawandel und natürliche Klimavariabilität
Wetterbedingte Gefahren stehen in komplexer Interdependenz mit natürlichen Klimaschwankungen wie der El Niño-Southern Oscillation. Diese klimatischen Muster beeinflussen die Häufigkeit und Intensität von Naturkatastrophen und damit auch das weltweite Schadengeschehen. Eine eindeutige kausale Attribution einzelner Extremereignisse zu spezifischen Klimamustern sowie die Quantifizierung klimawandelbedingter Einflüsse bleibt methodisch anspruchsvoll.
Steigende globale Temperaturen erhöhen das Risiko und Ausmaß von Naturgefahren – mit entsprechend zunehmendem Schadenpotenzial. Auch wenn klimawandelbedingte Verluste derzeit noch gering ausfallen, prognostizieren einige Studien, dass sie bis zur Mitte dieses Jahrhunderts zweistellige Prozentsätze des globalen BIP erreichen könnten.
4. Gravierende Deckungslücken
Trotz steigender Schäden fällt die Versicherungsdurchdringung in vielen Regionen gering aus. Allein im Jahr 2024 beliefen sich die Verluste durch Naturkatastrophen auf über 300 Milliarden US-Dollar, von denen lediglich 40% versichert waren. Immerhin: Der Anteil versicherter Schäden durch Naturkatastrophen steigt kontinuierlich, während sich die Protection Gap – die Differenz zwischen den gesamten wirtschaftlichen Schäden und den tatsächlich versicherten Schäden – verringert.
Allerdings bestehen erhebliche regionale Unterschiede: Die größten Deckungslücken und damit verbundenen finanziellen Risiken finden sich in Ländern des Globalen Südens. Es besteht die Notwendigkeit, Versicherungslücken global zu schließen und die finanzielle Resilienz in vulnerablen Regionen gezielt zu stärken.
Versicherer als Wegbereiter für Klimaresilienz
Standort und Bauweise von Vermögenswerten sind entscheidend für das Schadenpotenzial, da die Wahrscheinlichkeit von Naturkatastrophen zunimmt. Mitigationsmaßnahmen wie strengere Bauvorschriften, Standortanalysen und strategische Raumplanung sind unerlässlich. Versicherer können die Resilienz ihrer Kunden durch langfristige Investitionen und maßgeschneiderte Lösungen, wie Captives und ESG-Produkte, stärken. Hochspezialisierte NatCat-Bewertungstools und individuelles Climate Risk Consulting präzisieren die Risikobewertung und stärken die Widerstandsfähigkeit der Kunden gegenüber zukünftigen Herausforderungen – zuverlässig und nachhaltig. Entscheidend sind dazu langfristige Partnerschaften. (mho)

Globale Länderrisiken sinken