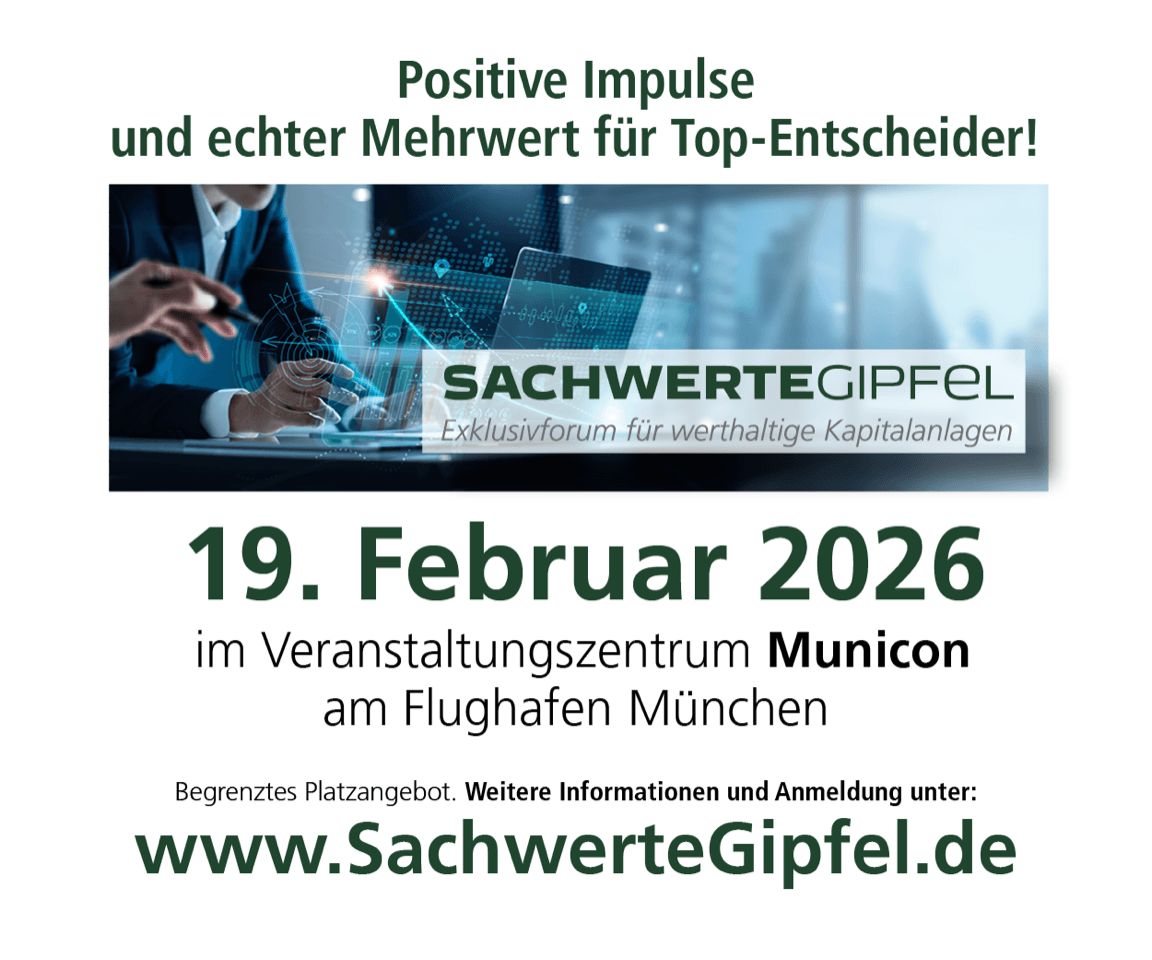Stromlos, aber handlungsfähig
29.08.2025

Foto: © VRVisionary - stock.adobe.com
Jüngste Stromausfälle in Spanien und Portugal haben gezeigt, wie verletzlich selbst hoch entwickelte Infrastrukturen sind. Flughäfen standen still, elektronische Zahlungssysteme fielen aus, der Zugang zu Datenzentren wurde blockiert – binnen Minuten kam das öffentliche Leben zum Erliegen. Für Finanzdienstleister, die auf Echtzeitverfügbarkeit und Verlässlichkeit angewiesen sind, ist ein Blackout weit mehr als ein Stromproblem. Es geht um Datenhoheit, operative Handlungsfähigkeit und letztlich um das Vertrauen der Kunden in die Stabilität des Systems. Banken, Versicherer und Investmentgesellschaften müssen deshalb über technische Resilienz hinausdenken.
Blackout – ein unterschätztes Sicherheitsrisiko
Die Vorstellung, dass in einer digitalisierten Welt nichts mehr funktioniert, sobald der Strom ausfällt, wirkt beunruhigend – und ist doch realistisch. Ein plötzlicher Blackout kann weitreichende Folgen haben: Geldautomaten und SB-Terminals versagen, Zugangskontrollen funktionieren nicht mehr, Kommunikationssysteme brechen ab, Serverräume überhitzen, Alarmanlagen schalten ab – und selbst Türen bleiben verriegelt. Viele IT-basierte Geschäftsprozesse sind auf eine stabile Energie- und Datenverbindung angewiesen. Fällt diese aus, geraten nicht nur Transaktionen ins Stocken, sondern auch sicherheitsrelevante Bereiche in akute Gefahr.
Vorbereiten statt improvisieren
Ein effektives Krisenmanagement beginnt nicht erst beim Ausfall, sondern bereits im Vorfeld. Es setzt voraus, dass Risiken systematisch bewertet und Szenarien analysiert werden. Ziel ist es, besonders verwundbare Systeme, Bereiche und Prozesse zu identifizieren – vom IT-Backend über das Zutrittsmanagement bis hin zu menschlichen Kommunikationsschnittstellen. Auf dieser Grundlage gilt es einen durchdachten Kommunikationsplan zu erstellen, der auch ohne digitale Infrastruktur funktioniert. Externe Sicherheitsdienstleister können dabei eine beratende und unterstützende Funktion übernehmen: Sie bringen das nötige Know-how mit, um maßgeschneiderte Sicherheitsstrategien zu entwickeln, die Infrastruktur, Prozesse und Menschen gleichermaßen berücksichtigen. Auch die Implementierung geordneter Evakuierungsabläufe, die Installation analoger Systeme sowie der personelle Schutz kritischer Bereiche können im Rahmen eines ganzheitlichen Sicherheitskonzepts geplant und umgesetzt werden.
Sicherheitsarchitektur neu denken
Cloudlösungen, redundante Rechenzentren oder dieselbetriebene Notstromaggregate allein genügen nicht. Ein ganzheitlicher Notfallplan muss auch die physische Sicherheit, den Zugang zu Gebäuden, den Schutz von Mitarbeitenden und die Aufrechterhaltung von Kommunikation in den Blick nehmen. Es benötigt ein umfassendes Krisenmanagement, das sowohl die digitale als auch die physische Sicherheit berücksichtigt. Eine elementare Herausforderung besteht darin, auch ohne Strom Zugang, Kommunikation und Koordination aufrechtzuerhalten. Zutrittssysteme sollten über mechanische Notöffnungen verfügen oder mit einer gesicherten Notstromversorgung gekoppelt sein. Alternativ bieten hybride Lösungen die Möglichkeit, zwischen elektronischem und mechanischem Betrieb zu wechseln.
In Krisensituationen leisten Sicherheitskräfte vor Ort nicht nur einen Beitrag zum Objektschutz, sondern auch zur Unterstützung von Mitarbeitenden, zur Koordination von Maßnahmen und zur Sicherung sensibler Bereiche. Evakuierungen oder temporärer Weiterbetrieb sind nur möglich, wenn die entsprechenden Räumlichkeiten ausreichend beleuchtet und mechanisch zugänglich bleiben. Hier können batteriegestützte Systeme oder USV-Anlagen (unterbrechungsfreie Stromversorgung) Abhilfe schaffen. Bei Ausfall der IT bieten sich alternative Kommunikationskanäle an – etwa über Satellitentelefone, Betriebsfunk oder gesicherte analoge Systeme. Mitarbeitende müssen wissen, was im Krisenfall zu tun ist. Das erfordert klar definierte Abläufe, Schulungen und regelmäßig geübte Notfallpläne.
Maßarbeit statt Standardlösungen
Je nach Branche und Betrieb unterscheiden sich die Anforderungen an ein funktionierendes Notfallkonzept. Banken müssen neben Filialschutz auch ihre SBInfrastruktur wie Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker, Serverräume und Kundenschalter absichern. Auch die Versorgung mit Bargeld wird bei längeren Ausfällen zur Herausforderung. Versicherungen benötigen für ihr Tagesgeschäft weiterhin den Zugang zu Vertrags- und Schadensdaten, ohne jedoch den Schutz sensibler Daten zu riskieren. Hier muss die Rückfallebene unter anderem papierbasierte Prozesse und entsprechend geschultes Personal umfassen.
Investmenthäuser sind hingegen stark auf Börsenanbindung und Marktdaten angewiesen. Ein Ausfall in diesem Bereich kann zu erheblichen Vermögensschäden führen. Hier hilft eine enge Abstimmung – bereits im Vorfeld – mit Rechenzentren, Telekommunikationspartnern und Sicherheitsdienstleistern. Pflegeimmobilien als Sonderform institutioneller Investments stehen unter besonderem Druck: Hier gilt es sowohl IT-gestützte Steuerungssysteme, zum Beispiel für Medikation oder Raumklima, als auch lebenserhaltende Infrastrukturen wie Aufzüge und Rufsysteme zu sichern.
Schnelles Reagieren im Krisenfall
Blackouts lassen sich nicht mit einem einzigen System verhindern. Sie erfordern ein Denken in Szenarien, ein Handeln in vernetzten Prozessen. Kommt es zum tatsächlichen Systemausfall, müssen Unternehmen sofort in den Krisenmodus wechseln können. Auch der beste Notfallplan bleibt wirkungslos, wenn die Belegschaft nicht darauf vorbereitet ist. Daher sind Schulung und Übung unverzichtbare Elemente jedes Sicherheitskonzepts. Regelmäßige Evakuierungsübungen stellen sicher, dass Mitarbeitende im Ernstfall schnell und koordiniert reagieren. Ebenso wichtig sind Einweisungen in den Umgang mit Notstromlösungen, manuellen Zugangssystemen und Kommunikationsmitteln. Ein gezieltes Kommunikationstraining bereitet Teams zudem auf den Umgang mit Unsicherheit und Stress vor – etwa durch das Einüben klarer Sprachregelungen, strukturierter Informationsweitergabe und Deeskalationsstrategien gegenüber Kunden. Diese „weichen Faktoren“ entscheiden oft über die Qualität der Krisenbewältigung.

Gastbeitrag von Gandhi Gabriel, Sicherheitsexperte und Geschäftsführer der SSB – Sicherheit, Service, Beratung GmbH.

Turbulenzen bei Yen und japanischen Staatsanleihen führen zu erheblichen Kapitalbewegungen