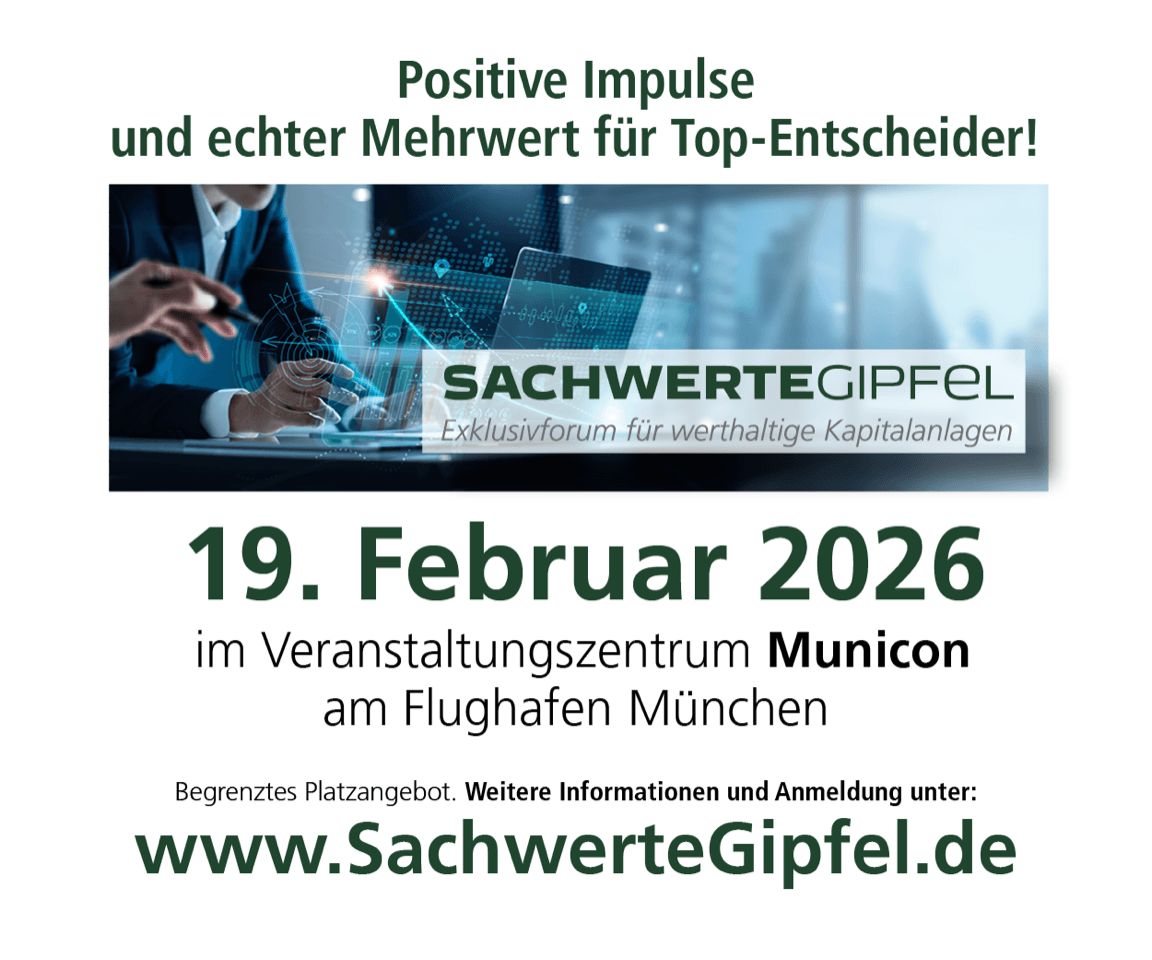Der Balanceakt der Notenbanken
08.10.2025

Foto: © nokturnal - stock.adobe.com
Die Geldpolitik gewinnt immer mehr an Bedeutung. Die Notenbanken sollen gleichzeitig für optimale Beschäftigung, stabile Preise und für adäquate Zinsen sorgen. Als Nebeneffekt sollen sie auch an den Börsen für „ruhige“ Kapitalmärkte bewirken. Denn ein Crash kann die Wirkungen ihrer Politik außer Kraft setzen. Zudem muss sie sich gegen politischen Druck zur Wehr setzen. Das ist in der Praxis oft schwierig, da Politik und Börse mitunter andere Ziele haben.
Seit den 80-er Jahren hatten sie zur Erfüllung ihres Mandats ein ideales Umfeld. So gaben die Zinsen für zehnjährige Schuldverschreibungen von Mitte 1981 bis zum September 2021 unter Schwankungen permanent nach. Ein ideales Umfeld für die Unternehmen. Sie konnten ihr Wachstum mit niederen Zinsen finanzieren. Sie waren innovativ und konnten so ihre Belegschaft nicht nur stabil halten, sondern sogar aufstocken. Auch die Erfindung des Internets unterstützte diese Situation. Die Firmen konnten so trotz steigender Personalkosten ihre Preise stabil halten, weil sie ihre Kosten (beispielsweise Globalisierung) senken konnten. Auch die Politik konnte ihre steigenden Ausgaben, auch für den sozialen Bereich, locker finanzieren und so zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Hinzu kamen in Deutschland der Fall der Mauer und die Einführung des Euros in den wichtigsten europäischen Staaten. Die Politik hatte noch für die Wirtschaft wichtige Visionen wie die Agenda 2010.
Wenn es den Menschen gut geht, neigen sie aber oft zur Bequemlichkeit. Der Slogan „weiter so“ hat alle glauben lassen, dass die Welt problemlos weiterläuft. Die Politik hat den immer größer werdenden Begehrlichkeiten zugestimmt, den Sozialstaat aufgebläht, und alles über Schulden finanziert und dies trotz kräftig steigenden Steuereinnahmen.
Alles war noch „im grünen Bereich“. Kritiker der Schuldenpolitik wurden belächelt. Selbst Börsencrashs wurden 2000 und 2009 mit Liquidität, also mit noch mehr Schulden erfolgreich bekämpft. So glaubte die Notenbanker ab 2011, dass man mit weiteren Schulden die schon wieder wachsenden Märkten noch mehr Wachstum „verordnen“ könnte. Entgegen allen Unkenrufen wurde weiter „Liquidität“ gedruckt. Noch immer verblieb die Inflation auf unter zwei Prozent, obwohl die Löhne sich recht gut entwickelten und die Arbeitszeit sogar gekürzt wurden. Die Industrie hatte vermehrt die teuren Produktionen ins preiswerte Ausland -meist Asien- verlegt und so die Produktionskosten reduziert.
Oberflächlich betrachtet waren die Menschen mit der Arbeit der Notenbanken zufrieden. Die Pandemie brachte die Wende. Die arbeitende Bevölkerung musste zuhause bleiben, Lieferketten wurden unterbrochen, die Produktion ging zurück, so dass die Nachfrage der Konsumenten nicht mehr befriedigt werden konnte. Dies führte zu steigenden Preisen, höheren Kosten der Industrie, Kurzarbeit für die Arbeitnehmer. Alle Probleme wurden durch weitere Staatsschulden bekämpft.
Spätestens seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine haben sich nicht nur die „Regeln“ verändert, sondern die Vergangenheit holt die Notenbanken jetzt ein. Ein FedVertreter ließ verlauten „wir sollen das Auto vorwärtsfahren, obwohl wir nur in den Rückspiegel schauen“. Die Globalisierung zeigt ihre Schrecken. Die unverantwortliche Schuldenmacherei auch. Trotzdem wird nicht von der Verschuldungspolitik abgewichen.
Ein Sparwille ist nicht vorhanden. So wird in Deutschland der Haushalt 2026 zu 30 Prozent über Schulden finanziert, Frankreich wird zum Verschuldungsproblem und USA hatte schon im Sommer mehr Schulden aufgenommen als im gesamten letzten Fiskaljahr. Über 37 Billionen Verbindlichkeiten lassen die Weltreservewährung schwächeln.
Entladen haben sich die Sünden der Vergangenheit in einer anspringenden Inflation. In Europa sind die Preise seit 2021 um über 23 Prozent gestiegen. Zölle, Kriege, Deglobalisierung und somit steigende Produktionskosten werden die Preissteigerungen weiter forcieren. Auch für September mussten höhere Steigerungsraten gemeldet werden. Mittendrin in dem Dilemma: Die Notenbanken. Die Gefahr weiter steigender Preise müssten sie mit höheren Zinsen bekämpfen. Dies würde die Gefahr einer Weltrezession dramatisch erhöhen. Ein schwächelndes Wirtschaftswachstum bräuchte niedrigere Zinsen. Geringere Schuldzinsen würden auch den hoch verschuldeten Staaten helfen, weil ein immer größer werdender Teil der Steuereinnahmen für Zinszahlungen verwendet werden muss und die Gelder dann für notwendige Investitionen fehlen. Die Inflation hätte „freien Lauf“. Seriöse Analysten und Ökonomen befürchten mittlerweile fatale Folgen für die Finanzmärkte. Die Schuldenbombe tickt. Doch weil wir uns an diesen angenehmen „Mechanismus“ gewöhnt haben und bisher ja alles gut gegangen ist, hören wir das Ticken nicht. Jetzt darf nichts mehr schiefgehen.
So langsam werden die Menschen aufmerksam für diese Probleme. Die Preissteigerungen zwingt sie, ihre Lebensart zu überdenken. Noch geht es uns problemlos gut. Noch steigen die Kapitalmärkte. Aber der Kanarienvogel der Finanzen (analog zur Kohlegrube) schlägt schon Alarm: Der Goldpreis! Der Kurs ist seit Ende 2015, also seit genau 10 Jahre, von 1.050 auf über 3.800 US-Dollar um mehr als 260 Prozent gestiegen, als wollte er zwitschern: Hier stimmt was nicht. Da die Politik immer noch nicht korrigiert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Gold weiter steigt. 5.000?, 10.000? …., wer weiß. Vor allem dann, wenn die Zweifel an einem gesunden Finanzsystem weiter steigen.
Das werden die Notenbanken versuchen zu verhindern. Aber bekämpfen sie die Inflation und belassen oder erhöhen sogar die Zinsen, dürfte die Weltwirtschaft in eine Rezession schlittern. Dann sind die Schulden nicht mehr bezahlbar. Entscheiden sie sich, die Zinsen zu senken, würde dies der Wirtschaft eventuell kurzzeitig helfen, aber man würde damit wohl auch eine höhere Inflationsrate in Kauf nehmen. Diese wird aber mit einem Timelag auch wieder die Wirtschaft negativ tangieren. Der zweite Kanarienvogel würde Explosionsalarm geben, wenn: Die 10-jährigen Zinsen überproportional steigen.
Nach der September Leitzinssenkung beispielsweise sind diese in den USA von 4,02 auf 4,15 Prozen angestiegen. Die Börsen werden wie meist abrupt, d.h. über Nacht das Vertrauen verlieren. Dann haben die Notenbanken nur noch eine Chance: Geld drucken, whatever it takes.

Marktkommentar von Rolf Ehlhardt, Vermögensverwalter, I.C.M. Independent Capital Management Vermögensberatung Mannheim GmbH.

BCA gewinnt Concordia Versicherungen als neue Produktpartnerin