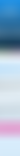„Die faulen Deutschen?“
05.08.2025
Foto: Guido Zander, Experte für Personalplanung und Autor des Buches „Die faulen Deutschen?“ © Haufe Verlag
Der Fachkräftemangel zählt zu den drängendsten Herausforderungen der deutschen Wirtschaft. Viele Diskussionen darüber werden inzwischen sehr polemisch geführt, meint Guido Zander, ein Experte für Personalplanung mit über drei Jahrzehnten Beratungserfahrung. In seinem Buch mit dem Titel „Die faulen Deutschen?“ untersucht er Schein-Debatten und zeigt Lösungen für eine zukunftsfähige Arbeitswelt auf. Im Interview erklärt Guido Zander, warum er sich für diesen provokanten Titel entschieden hat, was für und gegen eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit spricht und warum wir keine anderen Arbeitszeiten, sondern Innovation, Flexibilität und Transformation brauchen.
finanzwelt: Herr Zander, am 9. September erscheint Ihr Buch mit dem Titel „Die faulen Deutschen?“ im Haufe Verlag. Was hat Sie dazu inspiriert? Welche Zielgruppen sprechen Sie an?
Guido Zander: Mich das Ausmaß an Populismus in der Debatte so geärgert, dass ich einen Beitrag zu einer mehr faktenorientierten Diskussion beitragen wollte. Auslöser war im Herbst 2024 die Forderung diverser Politiker zur Einführung der 6-Tage-Woche nach griechischem Vorbild. Die Griechen hatten die gesetzliche Möglichkeit für eine 6-Tage-Woche geschaffen, die es bei uns ohnehin gibt. Auch heute arbeiten die Griechen immer noch nicht dauerhaft sechs Tage pro Woche. Dann fielen mir immer mehr Thesen auf, die ähnlich undifferenziert diskutiert werden wie z.B.: „die Deutschen sind Weltmeister im Krankfeiern“, „die Gen Z ist faul“, „wir müssen 42 Stunden pro Woche oder aber auch nur noch vier Tage pro Woche arbeiten“. In dem Buch habe ich all diese (und weitere) Thesen neutral und faktenbasiert bewertet. Als Zielgruppe sehe ich Geschäftsführer, Personalverantwortliche, Gewerkschafter und Politiker. Letztendlich ist das Buch aber für alle geeignet, die sich über diese Themen näher informieren möchten. Das Buch ist daher bewusst als Sach- und nicht als Fachbuch geschrieben worden.
finanzwelt: Warum haben Sie sich bewusst für diesen provokanten Titel entschieden?
Zander: Am Anfang wollten wir einen Titel mit Bezug zum Fachkräftemangel machen, weil die meisten Thesen in diesem Kontext geäußert wurden, konnten da aber keinen überzeugenden Titel finden. In allen Debatten schwingt aber immer mit: Wir müssen wieder mehr arbeiten, die Gen Z soll sich nicht so anstellen, wir müssen wieder weniger krank sein. Es gibt den Unterton: Früher waren wir fleißiger, weniger krank und die jungen Generationen leistungsorientierter als heute. Das alles ließ sich gut unter dem Titel „Die faulen Deutschen?“ subsumieren.
finanzwelt: Sie analysieren im Buch verschiedene Thesen zur Arbeitswelt. Welche dieser Debatten empfinden Sie aktuell als besonders schädlich oder irreführend?
Zander: Dass wir mit einer durchschnittlichen Wochenarbeitszeit von 33,4 Stunden pro Woche weit hinter anderen Ländern und früheren Zeiten liegen würden. Dabei lag 2024 die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit einer Vollzeitkraft mit 40,2 Stunden nahezu im europäischen Durchschnitt. Aber die Teilzeitquote hat sich seit 1991 mit 29 Prozent mehr als verdoppelt und mit 79 Prozent Erwerbstätigkeit der Frauen liegen wir in Europa auf Platz 2. Das hat 2023 mit 61,44 Mio. geleisteten Arbeitsstunden zu einem neuen Rekord geführt. Wir arbeiten also nicht weniger als früher und die Frauen mit der Doppelbelastung aus Care-Arbeit und Erwerbstätigkeit eher sogar mehr.
Von den brutto zur Verfügung stehenden Stunden bleiben netto allerdings durch viele Urlaubs- und Feiertage weniger übrig als in anderen Ländern. Das konnten wir uns aufgrund einer höheren Produktivität leisten, hier holen andere Länder aber auf.
finanzwelt: Sie setzen sich kritisch mit dem Narrativ auseinander, dass die Generation Z weniger leistungsbereit sei. Welche Daten sprechen aus Ihrer Sicht dagegen?
Zander: Dieses Narrativ wird mit der hohen Teilzeitquote in dieser Generation begründet, weil die ja alle nur noch 4 Tage arbeiten wollen. Und es gibt auch Fälle, bei denen dies so ist. Der Grund für die hohe Teilzeitquote ist aber der, dass der Anteil der Studierenden in dieser Generation von 3 Prozent 1980 auf 24 Prozent bei den Männern und sogar 39 Prozent bei den Frauen 2021 gestiegen ist. Und viele verdienen neben dem Studium in Teilzeit dazu. 2024 waren 76 Prozent in dieser Generation erwerbstätig, das ist ein neuer Rekord und spricht nicht für weniger Leistungsbereitschaft. Korrekt ist allerdings, dass die Ansprüche an den Job und die Arbeitgebenden gestiegen sind.

Daniel Bier Sheil kommt zu hep solar