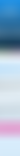„Die faulen Deutschen?“
05.08.2025
Foto: Guido Zander, Experte für Personalplanung und Autor des Buches „Die faulen Deutschen?“ © Haufe Verlag
finanzwelt: Wie bewerten Sie die Forderung nach einer 4-Tage-Woche aus volkswirtschaftlicher und betrieblicher Sicht?
Zander: Aus volkswirtschaftlicher Sicht halte ich eine 4-Tage-Woche für alle für nicht umsetzbar. Es gibt z.B. vollkontinuierliche Schichtbetriebe, wo dies nicht verlustfrei umzusetzen ist. Die Studien aus Island und England, die dies angeblich bewiesen haben, waren statistisch weder repräsentativ noch übertragbar und wurden darüber hinaus falsch interpretiert. Im Handwerk ist das aber durchaus möglich. Wenn man Montag bis Donnerstag auf den Baustellen etwas länger arbeitet und dafür den Freitag frei macht, spart man sich eine unproduktive Anfahrt zur Baustelle und ermöglicht den Mitarbeitenden ein dreitägiges Wochenende. Das ist für Mitarbeitende attraktiv und für den Arbeitgeber auch ohne Produktivitätsverluste umzusetzen. Die 4-Tage-Woche ist also ein Arbeitszeitmodell, das je nach Ausgangssituation passt oder auch nicht. Als pauschal verordnetes Modell wäre es aber standortschädigend.
finanzwelt: Viele Arbeitgeber fordern derzeit das Gegenteil, nämlich eine Ausweitung der Arbeitszeit. Was halten Sie davon?
Zander: Auch das ist in dieser Verallgemeinerung Humbug. Studien beweisen, dass die Krankenquote mit steigender Wochenarbeitszeit steigt und die Produktivität sinkt. Außerdem ist mittlerweile Flexibilität für die Betriebe viel wichtiger ist als mehr Arbeitsstunden. Die Auftragslagen schwanken öfter und mehr. Zusätzlich stehen Produktionen bereits heute immer wieder still, weil Produkte für den Produktionsprozess aufgrund fragiler Lieferketten fehlen. Daher gibt es bereits heute oft Leerzeiten, in denen Beschäftigte anwesend sind, aber nichts zu tun haben. Eine Ausweitung der Wochenarbeitszeit nur noch mehr Leerstunden. Diese Effekte würden den vermeintlichen Kapazitätsgewinn egalisieren und im ungünstigsten Fall sogar überkompensieren.
finanzwelt: In Ihrem Buch argumentieren Sie, dass nicht die Arbeitszeitmodelle, sondern strukturelle Innovation und Transformation im Zentrum stehen sollten. Was genau meinen Sie damit?
Zander: Die Arbeitszeitmodelle an sich sind schon im Fokus, nicht aber höhere Wochenarbeitszeiten. Mit flexibleren Modellen könnte man die aktuell vorhandene Arbeitszeit effizienter nutzen. Darüber hinaus führt kein Weg an der Automatisierung von Tätigkeiten vorbei. Die Menschen müssen nicht schneller oder länger arbeiten, sondern wir müssen Technologie an die Hand geben, um den gleichen Output mit weniger menschlichen Input zu schaffen. Hier wird KI eine große Rolle spielen.
Außerdem richten sich die Appelle nach mehr Arbeit an die, die bereits arbeiten. Der Fokus sollte eher darauf liegen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die diejenigen in die Lage versetzen mehr zu arbeiten, die das heute nicht können. Konkret heißt das, dass wir endlich die gesetzlich garantierte KITA-Struktur benötigten, und unser Schulsystem reformieren, das jährlich 35.000 „Absolventen“ ohne Schulabschluss produziert, die teilweise direkt in die Sozialsysteme wandern. Gleichzeitig verlassen viele arbeitsfähige Rentner den Arbeitsmarkt, weil es an Anreizen zur Weiterarbeit fehlt. Dass das jeweils besser geht, zeigen uns die skandinavischen Länder. Hier hätte die Politik genug Ansatzpunkte, die eigene Arbeitszeit sinnstiftend zu nutzen.
finanzwelt: Viele Unternehmen scheuen sich, bestehende Arbeitszeitmodelle zu hinterfragen. Was sind aus Ihrer Sicht die größten Barrieren in der Praxis und wie kann man diese überwinden?
Zander: In unseren Beratungsprojekten erleben wir eine gewisse Visionslosigkeit in Bezug auf das Thema Arbeitszeit. Viele arbeiten noch nach Modellen aus dem letzten Jahrhundert. Oft wird Excel als Einsatzplanungstool verwendet, was die Umsetzung individualisierter und flexibler Modell behindert, weil diese damit nicht mehr administrierbar wären. Dabei gibt es diverse ausgereifte Workforce-Management-Systeme, die per App integrierte Planungsprozesse ermöglichen, die gleichzeitig Mitarbeitende und Unternehmen flexibler machen. Eine zweite Barriere ist die Mitbestimmungspflicht der Mitarbeitervertretungen bei Arbeitszeitmodellen. Oft scheut man sich davor, so ein Fass aufzumachen. Dann hält man lieber noch ein paar Jahre mit den alten Modellen durch.
finanzwelt: Welche drei Empfehlungen würden Sie Entscheidern in Wirtschaft und Politik mitgeben?
Zander: Mit modernen und innovativen Arbeitszeitmodellen können Unternehmen gleichzeitig für Mitarbeitende attraktiver und wirtschaftlicher werden. Diese Modelle basieren auf mehr Vertrauen und weniger Kontrolle. Daher gebe ich folgende Empfehlungen:
- Vertrauen Sie Ihren Beschäftigten. Mindestens 80-90 Prozent sind leistungsbereit und vertrauenswürdig.
- Gehen Sie konsequent gegen Mitarbeitende vor, die das System ausnutzen und sich auf Kosten von Kolleginnen und Kollegen optimieren.
- Schaffen Sie (Arbeitszeit-)Regelungen, die den Leistungsbereiten Freiräume und Flexibilität geben und die Selbstoptimierer einbremsen, anstatt alle mit starren Regelungen einzugrenzen.
An die Politik hätte ich folgende Wünsche:
- Nutzen Sie Beamten- und Parteiapparate, um mit differenzierten Informationen Themen zu bearbeiten, anstatt vereinfachte und populistische Schnellschüsse loszulassen.
- Gehen Sie Themen wie Bildung, flexibler Renteneintritt, Kinderbetreuung und Migration / Integration an. Das sind die eigentlichen Hebel, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.
- Schaffen Sie ein Umfeld, in dem Automatisierung und KI gefördert werden, um die Arbeitsmenge mit weniger Arbeitskräften bewältigen zu können. (mho)

Daniel Bier Sheil kommt zu hep solar