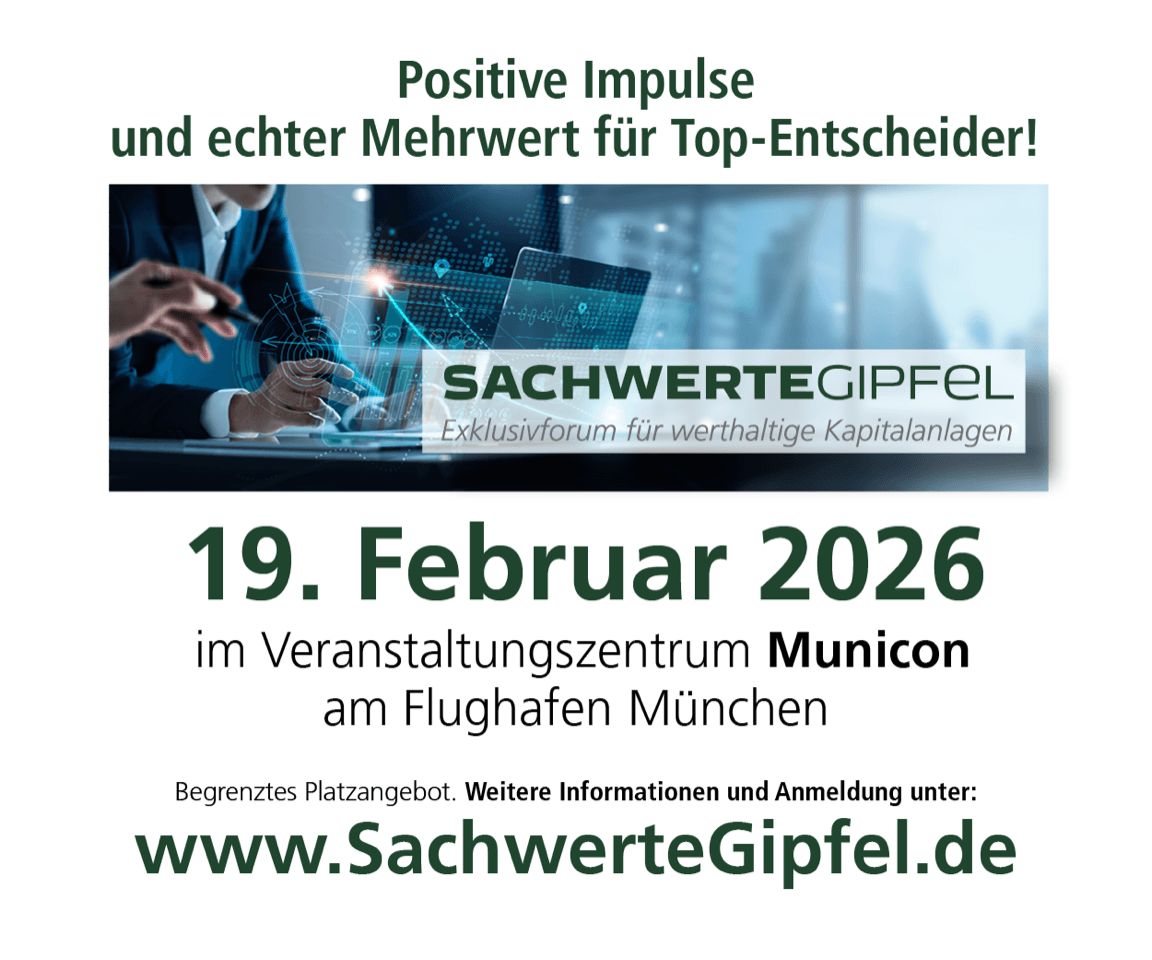Klimarisiken in der Landwirtschaft
21.05.2025

Foto: © oticki - stock.adobe.com
Extreme Wetterereignisse verursachen der Landwirtschaft in der EU derzeit jährlich durchschnittlich 28 Milliarden Euro Verlust. Bis 2050 steigen diese Verluste voraussichtlich jährlich auf bis zu 40 Milliarden Euro – größtenteils unversichert. Das geht aus dem Bericht „Versicherungs- und Risikomanagement-Instrumente für die Landwirtschaft in der EU“ hervor, den Howden, die Gruppe internationaler (Rück-) Versicherungsmakler, veröffentlicht hat. Der Bericht wurde von der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben.
Die möglichen finanziellen Verluste allein durch Dürre werden EU-weit auf bis zu 60 Milliarden Euro geschätzt. Dieser Risikowert wird bis 2050 auf 90 Milliarden Euro ansteigen und gefährdet dadurch die europäische Landwirtschaft, die Ernährungssicherheit sowie künftige Verbraucherpreise.
Howden sieht hier auf Basis der ausgewerteten Daten eine deutliche Versicherungslücke, die vor allem Landwirte betrifft: Sie haben 70-80% aller wetterbedingten Schäden selbst zu tragen, was in Folge Regierungen zur Auszahlung ungeplanter Katastrophenhilfen zwingt.
Die Empfehlungen des Berichts umfassen finanzielle Schutzmaßnahmen wie z.B. Katastrophenanleihen, Rückversicherungen und gegenseitige Risikopools sowie Anpassungsmaßnahmen auf allen Ebenen, um die Ernährungssicherheit Europas auch künftig zu gewährleisten.
Die wichtigsten Erkenntnisse
Die derzeitigen Durchschnittsverluste durch Klimarisiken in der EU – Dürre, Niederschlag, Hagel und Frost – entsprechen 6,4% der jährlichen Ernteerträge und steigen in schlechten Jahren auf über 10%.
Über 50% der gesamten landwirtschaftlichen Verluste sind auf Dürre als Ursache zurückzuführen, welche die größte Bedrohung in allen EU-Regionen darstellt.
Außerdem ist mit einer Zunahme von Frostschäden durch die fortschreitende Klimaerwärmung zu rechnen: Das frühere Knospen und Blühen von Reben und Obstbäumen führt während des Frühjahrsfrost zu verheerenderen Verlusten bei hochwertigen Trauben und Obstkulturen. Gleichzeitig werden häufigere und intensivere Stürme zu Verlusten durch Hagel und Überschwemmungen führen.
Hinzu kommt eine höhere Frequenz kleinerer Witterungs-Ereignisse, die den Aufbau von Reserven für weniger gute Jahre erschwert und sich zusätzlich in einer negativen Weise auf Erträge und Gewinne der Landwirte auswirkt.
Hinter den Daten auf EU-Ebene verbergen sich insgesamt erhebliche länderspezifische Unterschiede: In den kommenden Jahrzehnten könnten die Verluste allein in Spanien und Italien 20 Milliarden Euro erreichen. Kleineren europäischen Volkswirtschaften drohen sogar Einbußen von mehr als 3% ihrer BIPs.
Die Absicherungslücke
Nur 20-30% der klimabedingten Verluste in Europa sind versichert – sei es über öffentliche, private oder gegenseitige Schutz-Systeme (einschließlich der Vorkehrungen in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) Europas). Hinter diesen Durchschnittswerten verbergen sich deutliche Unterschiede im Versicherungs- Schutz von Anbau und Viehzucht – und zahlreiche Fälle, bei denen keinerlei Versicherungs-Schutz besteht. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass vorab vereinbarter Schutz, z.T. gefördert durch öffentliche Subventionen, für Landwirte und Kreditgeber weitaus effektiver ist als unzuverlässige und unvorhersehbare staatlich finanzierte Rettungsaktionen.
Empfehlungen
Um systemische Risiken zu reduzieren und wirtschaftliche Verluste für die Agrarindustrie und öffentliche Finanzen zu begrenzen, empfiehlt der Bericht ein datenbasiertes Risikomanagement sowie fortschrittlichere Risikotransfer-Mechanismen (einschließlich Katastrophenanleihen und öffentlich-private Rückversicherungsvereinbarungen). Der Bericht empfiehlt zudem, dass die EU dem Beispiel anderer Regierungen folgt und den Einsatz von Rückversicherungen und Katastrophenanleihen verstärkt. Dies ermöglicht, EU-Budgets besser zu schützen und im Katastrophenfall schneller notwendige Finanzmittel bereitzustellen. Darüber hinaus ist eine grundsätzliche Anpassung des gesamten Systems notwendig, um vor allem den unterversicherten Gebieten einen subventionierten Versicherungsschutz zu ermöglichen. Deckungskonzepte sollten die Klima-Resilienz sowohl auf Betriebs- als auch auf regionaler Ebene stärken, um die Versicherbarkeit aufrechtzuerhalten. (mho)

Neue Saison: Was Fahrer von Mofas und E-Scootern jetzt wissen sollten