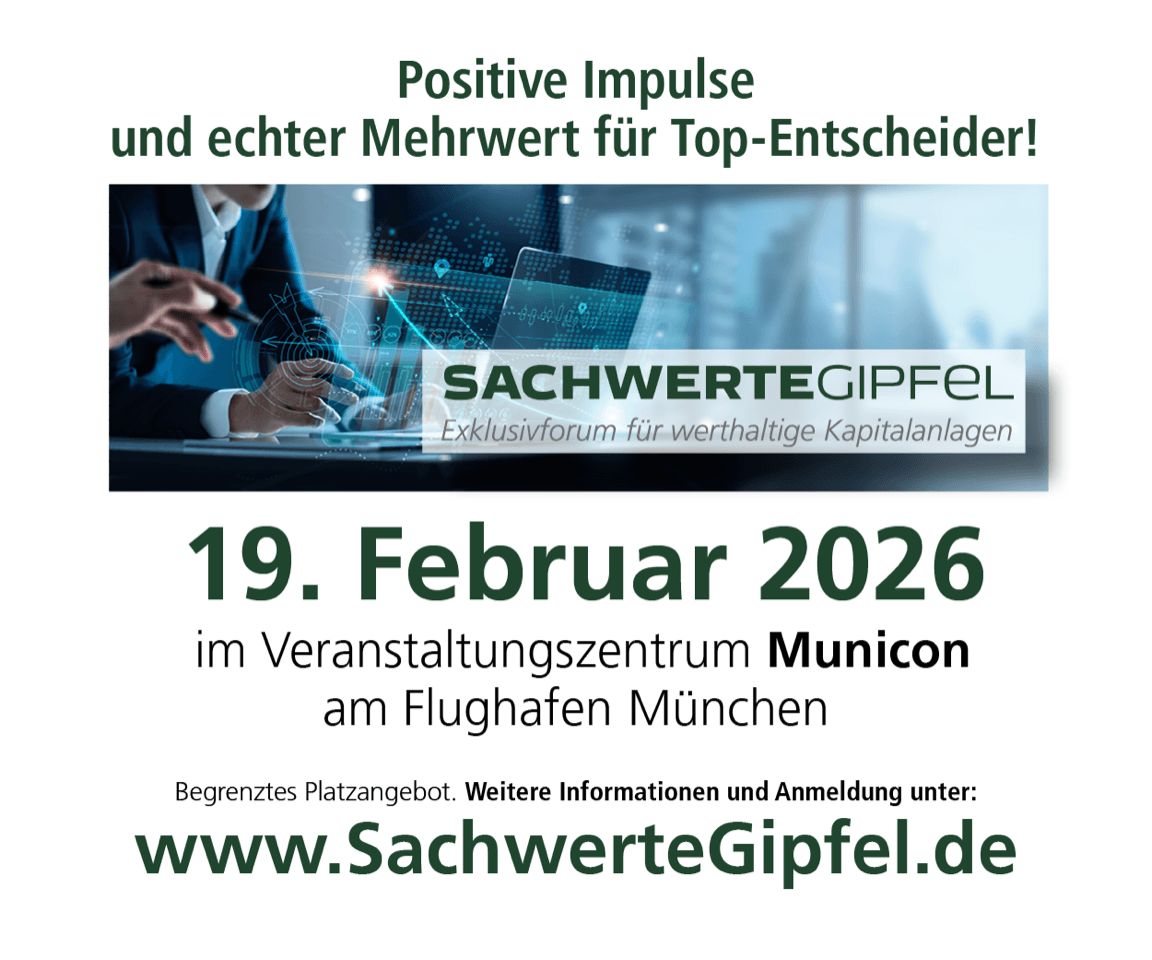Rückkehr zur Währungssicherheit?
29.10.2025

Foto: © Roman Bodnarchuk - stock.adobe.com
In Expertenkreisen wird erneut diskutiert, ob eine Rückkehr zum Goldstandard der Schulden- und Inflationsbekämpfung dienen könnte. Eine Idee, die bis in Projekte wie „Project 2025“ reicht. Während einige die restriktive und wertegebundene Stabilität betonen, verweisen Ökonomen darauf, dass historisch der Goldstandard wirtschaftspolitische Spielräume stark einschränkte und in Krisenzeiten schädlich sein kann. Eine ausgewogene Analyse wird beide Perspektiven beleuchten.
Der klassische Goldstandard prägte vom späten 19. bis ins frühe 20. Jahrhundert das internationale Finanzsystem. Staaten garantierten die Umtauschbarkeit ihrer Währungen in festgelegte Mengen Gold. Dies sorgte zwar für Vertrauen und Stabilität, band die Geldpolitik aber stark an externe Faktoren. In der Zwischenkriegszeit erwies sich diese Rigidität als fatal: In Phasen wirtschaftlicher Schocks konnten Staaten kaum gegensteuern, was Deflation und soziale Spannungen verschärfte. Mit der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre wurde der Goldstandard endgültig obsolet.
Eurokrise und neue Staatsverschuldung
Ein Blick auf die Eurokrise ab 2010 zeigt ähnliche Spannungsfelder: Hohe Staatsverschuldungen, fragile Bankensysteme und der Druck der Finanzmärkte setzten die Mitgliedsstaaten massiv unter Stress. Anders als unter einem starren Goldstandard ermöglichte die Europäische Zentralbank jedoch flexible Instrumente wie den Ankauf von Staatsanleihen, um das Auseinanderbrechen des Euroraums zu verhindern. Diese Flexibilität war entscheidend, um die Krise einzudämmen – auch wenn sie zu einer deutlich höheren Verschuldung führte. Heute, in einer Phase erneuter akuter Staatsverschuldung im Euroraum, wird die Frage nach soliden Ankermechanismen wieder lauter. Hier setzt die Debatte um den Digitalen Euro an, der als moderner Stabilitätsanker verstanden werden könnte. Gleichzeitig darf die Rolle des physischen Goldes als Krisenanker nicht unterschätzt werden. Gold gilt seit Jahrtausenden als „wahres Geld“, das unabhängig von politischen Entscheidungen oder der Stabilität einzelner Staaten seinen Wert behält. Ein stärkerer Rückgriff auf Goldreserven durch nationale Zentralbanken im Euroraum könnte daher eine zusätzliche Absicherung darstellen. Befürworter argumentieren, dass Gold im Gegensatz zu digitalen oder papierbasierten Versprechen nicht entwertet werden kann und in Zeiten geopolitischer Unsicherheit einen unersetzlichen Sachwert darstellt. Gegner dieser Sichtweise betonen jedoch, dass eine feste Bindung an Gold erneut zu starren wirtschaftspolitischen Zwängen führen würde.
Drei Optionen für die Zukunft
Aus der aktuellen Diskussion ergeben sich drei mögliche Pfade für die Stabilität des Euroraums:
1. Rückkehr zu einem klassischen Goldstandard
Stabilität durch Sachwertdeckung, jedoch mit erheblichen Einschränkungen für die Geldpolitik und hohen Kosten für den Aufbau ausreichender Goldreserven.
2. Stärkung institutioneller Regeln
Strenge Schuldenbremsen und fiskalische Disziplin könnten das Vertrauen in den Euro sichern, riskieren aber, in Krisenzeiten die nötige Flexibilität zu nehmen.
3. Ein hybrides Modell als „Goldstandard des Digitalen Euros“
Eine Kombination aus Vertrauen durch Diversifikation (inklusive Goldreserven als Krisenanker), klaren institutionellen Regeln und technologischer Modernisierung durch den Digitalen Euro. Dieses Modell könnte die Vorteile aller Ansätze bündeln und zugleich deren Schwächen abmildern.
Gerade dieses hybride Modell erscheint realistisch, insbesondere falls ein US-Präsident wie Donald Trump die Goldpreisbindung des alten Bretton-Woods-Systems aufheben sollte, um das amerikanische Finanzsystem aus der Krise zu führen. In einem solchen Szenario wären Goldpreise von 20.000 US-Dollar pro Unze keine Utopie mehr und der Digitale Euro, ergänzt durch institutionelle Regeln und Sachwertanker, könnte als Antwort Europas dienen.
Die Forderung nach dem Goldstandard des Digitalen Euros
Die Diskussion um den Digitalen Euro gewinnt an Fahrt – nicht nur als technologische Innovation, sondern auch als möglicher neuer Standard für Vertrauen und Stabilität im digitalen Zahlungsverkehr.
- Vertrauen als Fundament Der historische Goldstandard war vor allem ein Vertrauensanker: Der Wert des Geldes war an eine stabile Ressource gebunden. Der Digitale Euro könnte eine vergleichbare Rolle spielen – nicht durch Golddeckung, sondern durch die Garantie und Stabilität der Europäischen Zentralbank (EZB).
- Technologische Resilienz Ein Digitaler Euro muss höchste Ansprüche an Sicherheit, Datenschutz und Ausfallsicherheit erfüllen. Hier könnte er Maßstäbe setzen, die über reine Zahlungsfunktionen hinausgehen. Kryptografische Verfahren, europäische Cloud-Infrastrukturen und mögliche Offline-Fähigkeiten könnten zu einem neuen Referenzrahmen für digitale Währungen werden.
- Souveränität und Unabhängigkeit Mit dem Digitalen Euro stärkt Europa seine geldpolitische Souveränität. In einer Welt, in der Zahlungssysteme zunehmend von internationalen Tech-Giganten und nicht-europäischen Währungen geprägt werden, könnte der Digitale Euro zum Symbol europäischer Unabhängigkeit werden – vergleichbar mit dem Goldstandard, der nationale Währungen einst stabilisierte.
- Inklusion und Zugang Ein weiterer Aspekt des „neuen Goldstandards“ ist die Frage des Zugangs: Der Digitale Euro muss für alle Bürgerinnen und Bürger einfach nutzbar sein – unabhängig von technischer Ausstattung, Einkommen oder digitaler Kompetenz.
- Der Balanceakt zwischen Innovation und Regulierung Der Digitale Euro steht zwischen zwei Polen: technologischem Fortschritt und regulatorischer Kontrolle. Gelingt die Balance, könnte er nicht nur Zahlungsmittel, sondern ein Vertrauensanker für die gesamte europäische Digitalwirtschaft sein.
Der Digitale Euro hat das Potenzial, mehr zu sein als eine neue Form des Geldes. Er könnte den „Goldstandard des digitalen Zeitalters“ prägen – nicht durch physische Deckung, sondern durch Vertrauen, Stabilität, Souveränität und Inklusion. Entscheidend wird sein, ob es gelingt, Technik, Gesellschaft und Politik in Einklang zu bringen. Nur dann kann der Digitale Euro zum echten Stabilitätsanker für Europa werden.
Ein Beitrag von Martin Schröter, Diplom-Geologe, Unternehmer und Edelmetallberater

Edelmetalle boomen, Dollarreserven unter Druck, Bitcoin schwächelt