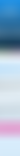Beginn einer neuen Zeitrechnung?
01.04.2013

Foto: © Sergey Nivens - Fotolia.com
Das harteWort „Währungskrieg" erweckt Erinnerungen an die Entwicklungen der 30er Jahre. Handelskrieg, Währungskrieg, heißer Krieg – die damaligen Regierungen machten alles falsch, was falsch gemacht werden konnte. Reale Gefahr oder Schlagwort – wo steht die Weltwirtschaft im Frühjahr 2013 und wie sollten sich Investoren ausrichten?
Die Politik zeigte sich auf demG20- Gipfel im Februar ungewohnt einmütig. „Es gibt keinen Währungskrieg“, sagte Angel Gurria, Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Aber ist der Verdacht, dass wir bereits mitten in einem Währungskrieg infolge des Abwertungswettlaufs der großen Zentralbanken stecken, so aus der Luft gegriffen? „Wir befinden uns inmitten eines internationalen Währungskriegs“, sagte der brasilianische Finanzminister Guido Mantega 2010. Zündstoff für die neuerliche Debatte um einen möglichen Kriegszustand erhielten Marktbeobachter durch Äußerungen der japanischen Regierung. Regierungschef Abe will mit einem niedrigen Yen die lahmende Exportwirtschaft ankurbeln und übt starken politischen Einfluss aus. Es gibt schon einen Namen dafür: Abenomics. Das bleibt nicht ohne Folgen: Der Yen hat seit Dezember 2012 gegenüber dem US-Dollar rund 15 % abgewertet, was seinerseits zu einer Rallye am japanischen Aktienmarkt geführt hat. Sollte dies Nachahmer hervorrufen, so könnte dies in einem weltweiten Abwertungswettlauf münden.
Neu ist dieses Phänomen nicht, zumal die Notenbanken auch in der Vergangenheit Währungspolitik betrieben haben und die jeweiligen Landeswährungen abwerteten, um die Wettbewerbsfähigkeit ihres Landes zu stärken. Die derzeitigen Dimensionen sind allerdings ungewohnt. Befragte Experten sehen momentan keinen Währungskrieg heraufziehen, verweisen jedoch auf die Gefahren der Geldpolitiken vieler Zentralbanken. Ulrich Leuchtmann, Leiter Devisen-Research bei der Commerzbank, sagt: „Währungskrieg bezeichnet eigentlich eine Situation, in der Zentralbanken direkt die Wechselkurse ihrer jeweiligen Währungen schwächen wollen. Allerdings wirken die Geldpolitiken vieler Zentralbanken ähnlich wie in einem Währungskrieg: Die Zentralbanken versuchen, mittels expansiver Liquiditätspolitik die heimische Konjunktur anzukurbeln und schwächen so – als willkommene Nebenwirkung – ihre Währungen.“ Markus Schuller, Gründer der Beratungsfirma für Alternative Investments Panthera Solutions, sieht auch keine Indizien eines Krieges, bemerkt aber, dass mitunter jedes G20-Mitglied versuche, sich durch die Währung einen Vorteil zu verschaffen, dies aber eben nur in graduellem Ausmaß.
Tatsächlich sind die Schwankungen der Devisenkurse historisch betrachtet klein und liefern keine weiteren Argumente zur Erhärtung des Verdachts der direkten Manipulation von Wechselkursen. Vice President, Global Capital Markets & Thematic Research bei Allianz Global Investors Stefan Scheurer fügt die Haltung der chinesischen Führung und der brasilianischen Notenbank (Aufwertung des Real im Vergleich zum US-$) an, die gegen ein globales Kriegsszenario sprechen würden. Welche Schlussfolgerungen lassen sich daraus ziehen? Wie reagiert der Euro? Die sehr lockere Geldpolitik in Japan und den USA haben die dortigen Währungen im Verhältnis zum Euro billiger gemacht. EZB-Präsident Mario Draghi, assistiert vom französischen Industrieminister Arnaud Montebourg, ließ mehrfach durchblicken, dass ein starker Euro die Wachstumsaussichten negativ beeinflussen könnte. „Wir rechnen für die kommenden Monate mit weiteren Unsicherheiten bezüglich Europa. Die Rezession in Italien, Frankreich und Spanien schränkt die Möglichkeiten der Politik ein, und schwächt somit auch das Vertrauen in die Währung“, sagt UBS-Devisenspezialist Thomas Flury. Laut AGI-Experte Scheurer wurden die strukturellen Verbesserungen im Euroraum wohlwollend von den Märkten zur Kenntnis genommen (Renditen, Risikoprämien), müssten jedoch ihrerseits weiter vorangetrieben werden. Wie wenig Lösungen die Lage im Euroraum tatsächlich bisher bietet, zeigt die Situation in Zypern. Der Euro war zeitweise nach der Einigung auf Hilfen für das pleitebedrohte Zypern unter Druck gekommen. Der weltgrößte Anleiheinvestor Pimco gab bekannt, sein Investment in den Euro zumindest kurzfristig zurückgefahren. „Wir haben unser Exposure im Euro reduziert“, sagte Saumil Parikh, Geschäftsführer bei Pimco, in einem Interview.
Steuern wir letztlich auf ein „neues“ Weltwährungssystem zu? Parallel zum US-Dollar und Euro wird die chinesische Währung in Zukunft wesentlich an Bedeutung gewinnen, was nicht nur unter Experten unumstritten ist. Fakt ist: Immer mehr Investoren entdecken den chinesischen Renminbi (Yuan) für sich und können auf die kommende Weltwährung setzen. Diese verfügt über eine Besonderheit: Die Währung ist nicht frei konvertibel. Der Wechselkurs ist in der Volksrepublik Chefsache. Während die Regierung den Kurs zum US-Dollar vor allem zu Beginn der Aufschwungphase bewusst gering halten wollte, um die eigenen Exporte zu vergünstigen, lässt Peking seit 2005 eine langsame Aufwertung zu. 2002 mussten Anleger für einen US-Dollar noch über acht Yuan bezahlen. Inzwischen werden um die 6,20 Yuan fällig. Allerdings ist es noch ein langer und steiniger Weg, bis die chinesische Währung in einem Atemzug mit dem US-Dollar genannt werden könnte. „Chinas Regimemuss in einemersten Schritt die noch bestehenden Restriktionen im CNY-Handel (Kapitalverkehrskontrollen, Beschränkung der Konvertierbarkeit) aufheben. Doch selbst dann ist der Renminbi als Welt-Leitwährung ungeeignet. Dazu müsste ein breiter, offener und mit hoher Rechtssicherheit ausgestatteter Kapitalmarkt entstehen“, fügt Leuchtmann an. Neue chinesische Anleihen (Dim Sum Bonds) eröffnen Investoren bereits jetzt die Chance, vom Aufstieg der Volkswährung zu profitieren. Im vergangenen Jahr wurden 230 Mrd. Renminbi solcher Anleihen begeben, ein Anstieg von 60 % gegenüber dem Vorjahr.
Fazit. Ob wir uns in einem offenen Währungskrieg befinden, ist noch fraglich. Dennoch ist die Tatsache, dass die Geldpolitik vieler Zentralbanken im Wesentlichen ähnlich wirkt, bedenklich. Für diesen Fall ist es notwendig, sich darauf einzustellen, dass ein „kalter Währungskrieg“ stattfinden kann. Die Liquiditätsschwemme soll die Wirtschaft anheizen und hat vorerst eine gefühlte Beruhigung der Finanzmärkte gebracht. Investoren sollten ihre Währungsallokation überprüfen – eine Alternative zum US-Dollar und Euro sind Fonds, die auf Papiere in der aufstrebenden chinesischen Währung setzen. Diese gibt es unter anderem von ACM Bernstein, AGI, Berenberg, BlackRock, Fidelity oder HSBC.
_
Alexander Heftrich_
Währungskrieg - Printausgabe 02/2013
http://finanzwelt.de/wp-content/uploads/Geldmengen_der_Zentralbanken.pdf

„Es geht um den sportlichen, nicht um den finanziellen Erfolg“