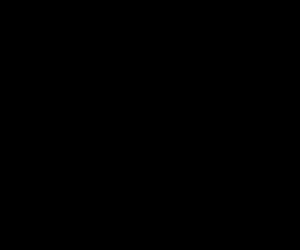Die Staatsschuldenkrise: Wie ernst ist die Lage?
15.12.2025
Benjamin Suermann - Foto: Copyright nordIX AG
Frankreichs steigende Staatsverschuldung und politische Instabilität bereiten Investoren Sorgen, trotz der Möglichkeit einer EZB-Intervention. Auch in den USA gibt es Bedenken wegen der hohen Staatsverschuldung und den gleichzeitig geringen Ambitionen, diese nachhaltig zu reduzieren. Investoren suchen nach sicheren Anlagen, wobei Unternehmensanleihen bester Bonität zunehmend attraktiv erscheinen.
Frankreich sorgte zuletzt verstärkt für Schlagzeilen, zu einem spektakulärer Raub auf das Louvre gesellten sich in den gängigen Gazetten Artikel über die derzeitige Regierungskrise im Zuge derer mit Sébastien Lecornu beispielsweise ein neuer Premierminister ins Amt trat, der dieses nach ca. einem Monat schon wieder verlas, nur um dann alsbald wieder als neuer Premier gewählt zu werden. Gleichzeitig bereiten ausufernde Schulden, Arbeitslosigkeit, defizitäre Haushaltspläne und politische Uneinigkeit gepaart mit Downgrades der großen Ratingagenturen Investoren weltweit zunehmend Zweifel an der Kreditwürdigkeit der „Grande Nation“. Blickt man derweilen über den Atlantik zeichnet sich in Amerika ein teilweise vergleichbares Bild ab, bisher aber immerhin ohne jüngstes Downgrade und mit mehr Dynamik in der Wirtschaft. Dennoch regen dort das offensichtliche Scheitern der Bemühungen des „Department of Government Efficiency“ und die ausufernde Staatsverschuldung (derzeit ca. 38 Billionen US-Dollar, Tendenz steigend) aber ähnliche Sorgen. Abgerundet wird dieses Bild mit langjährigen Aufwärtstrends in Edelmetallen oder Kryptowährungen, und somit also Investmentgattungen derer vornehmender Zweck die Wertaufbewahrung bzw. Werterhaltung ist („store of value“). Grund genug also einmal genauer hinter die Entwicklungen zu schauen, die die Weltfinanzmärkte zur Zeit beschäftigen.
„Too big too fail“: Bisher nur bekannt aus der Bankenwelt
Frankreichs Staatsverschuldung liegt derzeit bei ca. 115 Prozent des BIP während das Fiskaldefizit für 2025 in etwa 5,4 Prozent betragen soll. Ein beachtlich hoher Wert, gegeben der Tatsache, dass Frankreich derzeit nicht direkt von einer Krise betroffen ist, und die massiven Hilfspakete der Corona-Zeit zudem eigentlich fiskalische Zurückhaltung in den Folgejahren voraussetzen würden. Zwar soll das Defizit auf 4,7 Prozent in 2026 fallen, doch der fehlende parlamentarische Konsens untergräbt die Glaubwürdigkeit dieser Pläne. Wirtschaftlich droht Stagnation: Das BIP-Wachstum wird auf lediglich 0,6 Prozent prognostiziert, gebremst durch politische Unsicherheit und schwache Exporte. Die Inflation hingegen ist mit leicht über zwei Prozent jährlicher Teuerung wieder am Zielkorridor der EZB angelangt, stellt aber einen schwachen Trost angesichts einer Arbeitslosenquote von 7,5 Prozent und steigender Jugendarbeitslosigkeit dar, die auf tieferliegende Strukturschwächen hindeutet. Wohlhabende Franzosen und Unternehmen treiben Kapitalströme nach Luxemburg und in die Schweiz, was die Steuerbasis weiter untergräbt. Die Renditen französischer Zehnjahresanleihen handeln derzeit ca. 75 Basispunkte über denen gleichlaufender Deutscher Papiere, wobei selbst Italien trotz schlechterem Rating sich derzeit günstiger Refinanzieren kann als Frankreich. Die Möglichkeit der Emittierung etwaiger EU-Bonds für Verteidigungsprojekte und andere strukturelle Treiber (unter anderem auch das TARGET-System) halten die Zinsdifferentiale dabei in den Augen mancher Kapitalmarktaktuere künstlich niedrig, letztlich aber aus der durchaus begründeten Vermutung heraus, dass die EZB Frankreich im Krisenfall zu Hilfe kommen würde.
Bevor die EZB aber den politischen Willen fassen kann, den ein Eingreifen a la Draghi („Whatever it takes“) benötigen würde, ist eine weitere Verschlechterung der Lage wohl aber notwendig. In welcher Form die Intervention stattfindet ist ebenfalls unklar, zwar ist die direkte Finanzierung der Staatsschulden in den Statuten der EZB als unzulässig eingestuft, allerdings haben sich die Frankfurter Zentralbänker in der Vergangenheit als durchaus kreativ erwiesen, wenn es um das Entwerfen neuer geldpolitischer „Instrumente“ geht. Das derweilen die meisten Mitgliedsstaaten auch die Vorgaben der Maastrichter Verträge quasi durchgehend verletzen fällt mitunter auch kaum mehr auf. Der 10-jährige Bund-Swap-Spread – die Differenz zwischen Bund-Rendite und Zinsswaps gleicher Laufzeit – misst das relative Vertrauen in Staatsanleihen gegenüber ungesicherten Bankzinsen. Über die letzten Jahrzehnte hinweg rentierten die Swaps gemittelt etwa 35 Basispunkte höher als von Deutschland emittierte Bonds, derzeit versprechen beide Instrumente aber in etwa die selbe Verzinsung. Die Annäherung beider Zinssätze steht sinnbildlich für das einerseits wiedererstarkte Vertrauen in den Bankensektor, andererseits aber auch für eben jene Erosion des Vertrauens in die fiskalische Tragfähigkeit der Staaten.
Und was nun?
Zwar gilt in Kapitalmarktfragen das Axiom „There is no sure thing!“. Dennoch ist ein klassischer Default, wie er derzeit und zum wiederholten Male beispielsweise in Argentinien betrachtet werden kann, bei Emittenten wie Frankreich, den Vereinigten Staaten oder auch Japan nicht zu erwarten. Dafür sprechen nicht nur die am Markt gehandelten Levels für Kreditausfallversicherungen (CDS) auf die genannten Staaten, sondern auch die Tatsache, dass diese Emittenten die Währung in der sie verschuldet sind quasi selbst drucken können und die äußerst regelmäßig stattfindenden Auktionen für neue Schuldenpapier fortlaufend Käufer sehen. Für Investoren ausschlaggebend ist daher weniger die Sorge, dass sie an die genannten Staaten geliehenes Geld nicht wieder zurückerhalten, sondern viel eher, dass dieses Geld auch inklusive der hinzukommenden Zinsen letztlich inflationsbereinigt eine zu geringe Rendite verspricht, wobei die Analyse hier natürlich immer auch eine Funktion derjenigen Renditen ist, die man in anderen Assetklassen oder Anleihen von Unternehmen erwirtschaften kann. Die politische Maneuvrierunfähigkeit hinsichtlich der Haushaltsplanung vieler entwickelter Länder lässt ebenfalls wenig Hoffnung zu.
Historisch betrachtet sind solche ausufernden Schuldenlasten mitsamt (Finanz-)Krise ein häufig und regelmäßig zu beobachtendes Phänomen. Bevor sich Politik und Bevölkerung der Problematik aber tatsächlich annehmen und Änderungen durchgesetzt werden erfolgt zumeist eine Zuspitzung der Krise an einen Punkt, der kaum eine Alternative zulässt. Von einem solchen sind auch die verschuldeteren Gläubiger der OECD bisher wohl noch ein gutes Stück entfernt. Insofern war das Projekt „DOGE“ in Amerika eine Art Ausnahme und hätte einen Lichtblick darstellen können (wobei das schnelle Scheitern nun eher noch größere Sorgen bereitet), in einer Welt in der die Verantwortlichen zumeist nach dem Credo „Kicking the can down the road“ verfahren, also Probleme tendenziell in die Amtszeit der Nachfolger zu überbrücken, anstatt nachhaltige und oftmals schmerzhafte Maßnahmen zu ergreifen. Verständlich ist das, so ist in den modernen Demokratien keinem einzelnen Politiker die Schuld an sich seit Jahrzehnten auftürmenden Schuldenbergen zuzuschreiben, warum also sollte ein einzelner nun seine politische Karriere mit quasi in jeder politischen Richtung unbeliebten Entschuldungsplänen belasten.
Zahlungsausfälle bei großen Staaten sind auf Sicht nicht zu erwarten
Andere Wege aus der Schuldenkrise wären weitere inflationäre Schübe, die bisher ausstehenden Schulden in realen Größen entwerten aber meist die soziale Ungleichheit verschärfen und politische Unruhen auslösen können, was in den letzten beiden Jahrzehnten in gewisser Weise so auch schon zu beobachten ist. Die wohl schönste Lösung wäre ein massiver Wachstums- und Produktivitätsschub durch technologischen Fortschritt, echtes Wachstum würde die Schuldenquoten auch ohne Sparprogramme senken und zudem neuen Optimismus und letztlich Vertrauen schaffen. Amerika setzt derzeit in gewisser Weise vieles auf diese Karte, unter anderem mit Investitionen in bisher kaum gesehenen Ausmaß in den KI-Bereich. In Anbetracht der Alternativen wäre dies sicherlich wünschenswert. Für Investoren ist demnach aber sicherlich Vorsicht geboten. Obwohl Zahlungsausfälle bei großen Staaten auf Sicht nicht zu erwarten sind bleiben Investitionen in Staatsanleihen eine insofern riskante Investition, als das die Renditen in inflationsbereinigten oder volatilitätsadjustierten Größen derzeit wenig attraktiv wirken. Wer nun aber in vermeintlich sichere Häfen wie Gold oder Bitcoin segeln möchte stellt fest, dass diese Lösung über die letzten Jahre derart populär geworden ist, dass auch hier mit einigem an Volatilität und eventuellen Kursabschlägen gerechnet werden muss. Im derzeitigen Umfeld erweisen sich daher zunehmend auch Unternehmensanleihen bester Bonität als Zufluchtsort für risikoaverses Kapital.
Gastautor: Benjamin Suermann, Portfoliomanager beim Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX AG

Finanzmärkte reagieren vorsichtig auf Iran-Konflikt