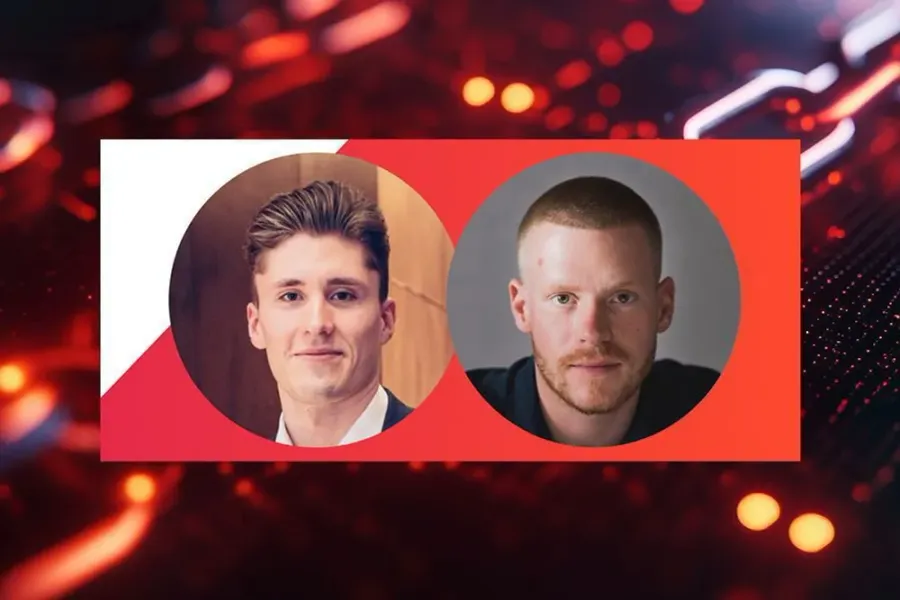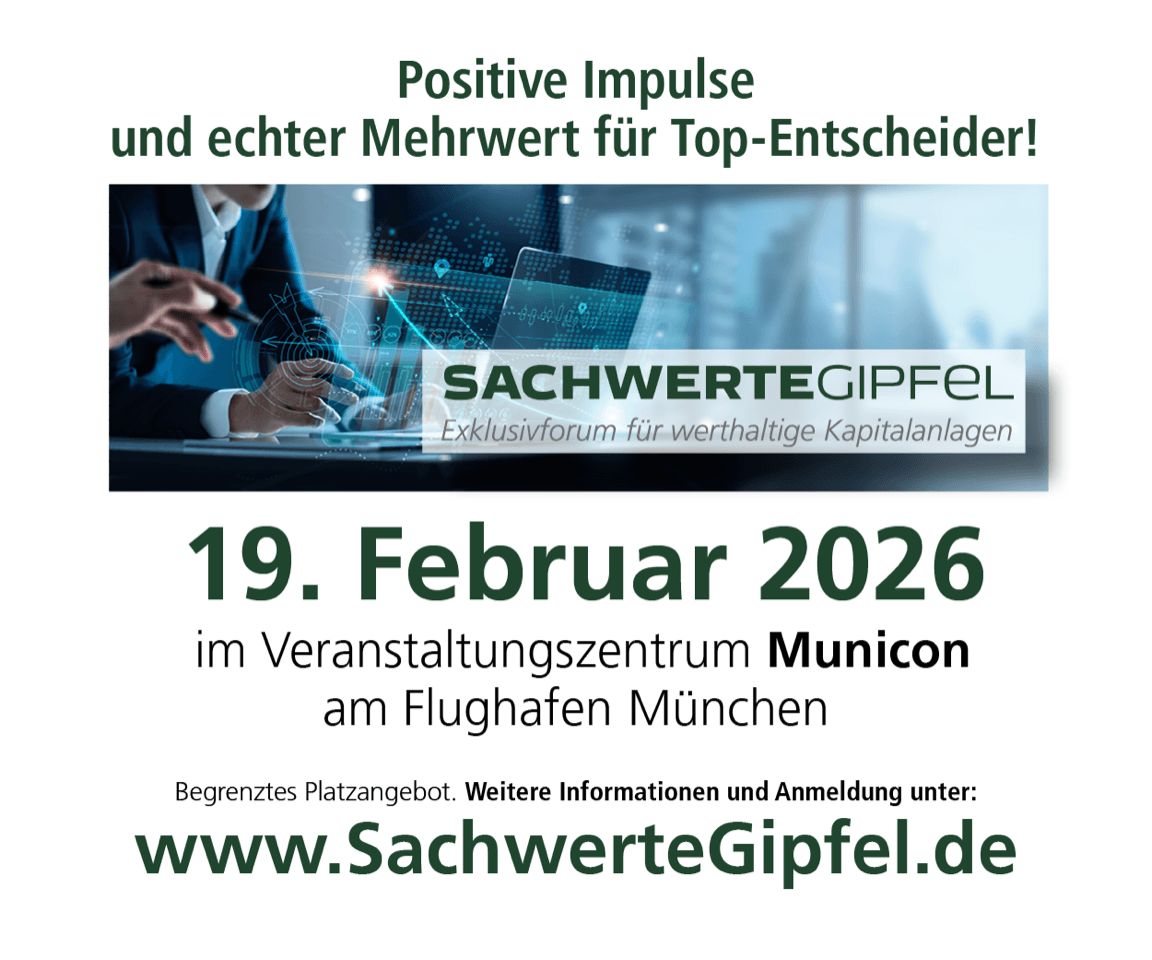KryptoKlartext Episode 8: Interoperabiliät im Web3 - Brücken statt Silos
29.10.2025

Philip Fihol und Philipp Sandor / Foto: © Melek - stock.adobe.com
in den letzten Episoden haben wir verschiedene Aspekte des Blockchain- und Krypto-Ökosystems beleuchtet – von Wallets über Tokenisierung und DeFi bis hin zu NFTs. Heute widmen wir uns einem Thema, das in den kommenden Jahren über den Erfolg oder Misserfolg des gesamten Web3-Ökosystems entscheiden könnte: Interoperabilität. Die Frage, wie man ein dezentrales Ökosystem aufbaut, ohne neue Hürden zu errichten, beschäftigt Entwickler, Investoren und Institutionen gleichermaßen. Mit über hundert aktiven Blockchains weltweit stellt sich unweigerlich die Frage: Befördert uns diese Vielfalt in Richtung maximaler Effizienz – oder schaffen wir nur neue Silos, die wir mühsam wieder miteinander verbinden müssen?
Was bedeutet Interoperabilität im Web3?
Stellen Sie sich Web3 als eine Welt mit vielen „digitalen Inseln“ vor. Jede Insel ist eine Blockchain mit eigenen Regeln, Sprachen und Bewohnern. Praktisch bedeutet das: Ein Bitcoin kann nicht einfach auf die Ethereum-Insel reisen, genauso wie Dollar nicht direkt in Euro umgetauscht werden, ohne eine Bank dazwischen. Diese Trennung sorgt für viele praktische Probleme – besonders wenn Unternehmen Dienstleistungen auf mehreren Blockchains anbieten wollen. Hier kommt Interoperabilität ins Spiel: Sie ist wie eine Brücke zwischen den Inseln, über die Menschen, Güter und Informationen sicher und direkt reisen können. Das Ziel ist ein Ökosystem, in dem sich unterschiedliche Blockchains unkompliziert verbinden – ohne, dass sich Nutzer mit technischen Details auseinandersetzen müssen.
Industrieller Blickwinkel: Warum Unternehmen Interoperabilität brauchen
Aus einer industriellen Perspektive ist Interoperabilität kein „nice-to-have“, sondern eine notwendige Bedingung. Institutionelle Investoren, Banken oder Emittenten tokenisierter Assets werden keine parallelen Infrastrukturen für jede Blockchain betreiben. Sie benötigen Schnittstellen, Standards und Prozesse, die kompatibel und skalierbar sind. Ein Beispiel: Wenn eine Bank eine tokenisierte Anleihe auf einer privaten Permissioned-Chain emittiert, ein Investor aber nur eine Public-Chain-Infrastruktur wie Ethereum nutzen darf, entsteht ein Reibungsverlust. Der Mehrwert der Tokenisierung verpufft, wenn beide Parteien ihre Systeme nicht verbinden können. Interoperabilität ist damit nicht nur technisches Problem, sondern ökonomische Notwendigkeit. Nur wenn Blockchains miteinander sprechen, kann ein effizienter Markt entstehen.
Die Brücken: Wie funktioniert das technisch?
Keine Sorge, jetzt wird es nicht zu technisch. BlockchainBrücken sind Protokolle, die verschiedene Blockchains miteinander verbinden – ähnlich wie der Eurotunnel zwischen Frankreich und England.
- Bei dezentralen Brücken wird ein Wert (z. B. ein Token) auf Blockchain A „eingefroren“ (gesperrt) und ein gleicher Wert auf Blockchain B ausgegeben. Später kann das Ganze auch wieder rückgängig gemacht werden.
- Zentralisierte Brücken funktionieren eher wie klassische Finanzdienstleister – ein vertrauenswürdiger Vermittler hält den Originalwert „in Verwahrung“ und stellt im anderen Netzwerk eine Kopie aus.
Beides ermöglicht den Transfer von Vermögenswerten und Informationen – seien es Bitcoin, Ethereum oder NFTs. Eine weitere Form der Interoperabilität bieten sogenannte RelayChains. Man kann sie sich wie eine zentrale Autobahn vorstellen, an die viele Zufahrten angeschlossen sind – also die einzelnen Blockchains. Jede Zufahrt (Parachains bei Polkadot, Zonen bei Cosmos) bringt eigene Regeln und Anwendungen mit. Die Relay-Chain sorgt dafür, dass der Verkehr – Daten, Tokens oder Nachrichten – geregelt, sicher und schnell zwischen den Zufahrten fließen kann, ohne Staus, Umwege oder unnötige Zwischenhändler. Doch jede Brücke ist auch ein potenzieller Schwachpunkt. Zahlreiche Hacks und Sicherheitsvorfälle zeigen, dass hier noch viel Innovation nötig ist.
Mögliche Stolpersteine: Sicherheit und Standardisierung
Kein Vorteil ohne Risiko: Gerade die Brücken zwischen Blockchains waren in den letzten Jahren wiederholt Ziel spektakulärer Hacks. Sie sind das Einfallstor, wenn Vermögenswerte zwischen Netzwerken bewegt werden – und damit ein besonders attraktives Angriffsziel. Rund zwei Drittel aller großen DeFi-Hacks der letzten Jahre betrafen CrossChain-Bridges. Eines der bekanntesten Beispiele ist der Angriff auf die Ronin-Bridge im Jahr 2022, bei dem Angreifer mehr als 600 Mio. US-Dollar erbeuteten, indem sie die privaten Schlüssel der Validatoren kompromittierten. Ein weiterer großer Vorfall betraf die Wormhole-Bridge, über die Hacker rund 320 Mio. US-Dollar entwenden konnten, weil eine Schwachstelle in der Signaturprüfung ausgenutzt wurde. Solche Fälle zeigen: Ohne industrielle Standards, unabhängige Audits und eine konsequente Weiterentwicklung der Technologie droht, Interoperabilität zur neuen Schwachstelle des Ökosystems zu werden.
Die Kehrseite: Risiken durch zu viel Vernetzung
Während mangelnde Interoperabilität Märkte fragmentiert, birgt zu viel Interoperabilität ebenfalls Risiken. Wenn alle Blockchains durch Bridges und gemeinsame Protokolle verbunden sind, entsteht ein Systemverbund, der anfällig für Kaskadeneffekte ist. Ein Beispiel aus der Finanzwelt: Die Lehman-Pleite 2008 breitete sich nicht wegen der Größe der Bank aus, sondern wegen der engen Vernetzung über Derivate und Interbanken-Märkte. Übertragen auf Web3 bedeutet das: Ein Hack in einer zentralen Bridge könnte das gesamte Ökosystem destabilisieren. Deshalb braucht es balancierte Interoperabilität: Verbindungen, die sicher und standardisiert sind, aber nicht das gesamte System in Mitleidenschaft ziehen können.
Werden hunderte verschiedene Blockchains wirklich effizient sein?
Die Vielfalt der Blockchains wirkt auf den ersten Blick verwirrend. Doch der Markt zeigt: Jede Blockchain bringt andere Stärken mit. Ethereum ist flexibel und beliebt bei Entwicklern, Solana liefert hohe Geschwindigkeit, Cosmos und Polkadot sind „Brückenbauer“. Durch Interoperabilität können für jede Anwendung die optimalen Bausteine genutzt werden – und zwar im Hintergrund, so dass Nutzer und Unternehmen nur noch die Vorteile spüren und keine Hürden überwinden müssen. Das Ziel ist, dass Blockchains im Alltag kaum noch auffallen: Sie arbeiten miteinander und machen das Ökosystem stabiler, schneller und vielseitiger.
Fazit: Brücken bauen, nicht neue Mauern
Interoperabilität ist die Bedingung dafür, dass Web3 mehr wird als ein Flickenteppich von Insellösungen. Nur wenn wir es schaffen, Blockchains so miteinander zu verbinden, dass Werte, Daten und Identitäten nahtlos und sicher übertragen werden können, entsteht ein wirklich dezentrales Finanzökosystem. Doch der Weg dorthin ist kein Selbstläufer. Es braucht technische Innovation, regulatorische Klarheit und den Mut der Industrie, gemeinsam an Standards zu arbeiten. Nur so verhindern wir, dass aus dem Traum der Dezentralisierung ein Albtraum aus neuen Mauern und alten Silos wird. Die Vision: Ein Internet, in dem Blockchains im Hintergrund agieren und Nutzer, Unternehmen sowie Maschinen frei und unkompliziert miteinander interagieren – ohne neue Hürden beim Zugang oder im Alltag. Ein echtes Netzwerk, das den digitalen Wandel vorantreibt und die Finanzwelt revolutioniert.

Kryptobörsen im Wandel: Vom Handelsplatz zum Finanzintermediär