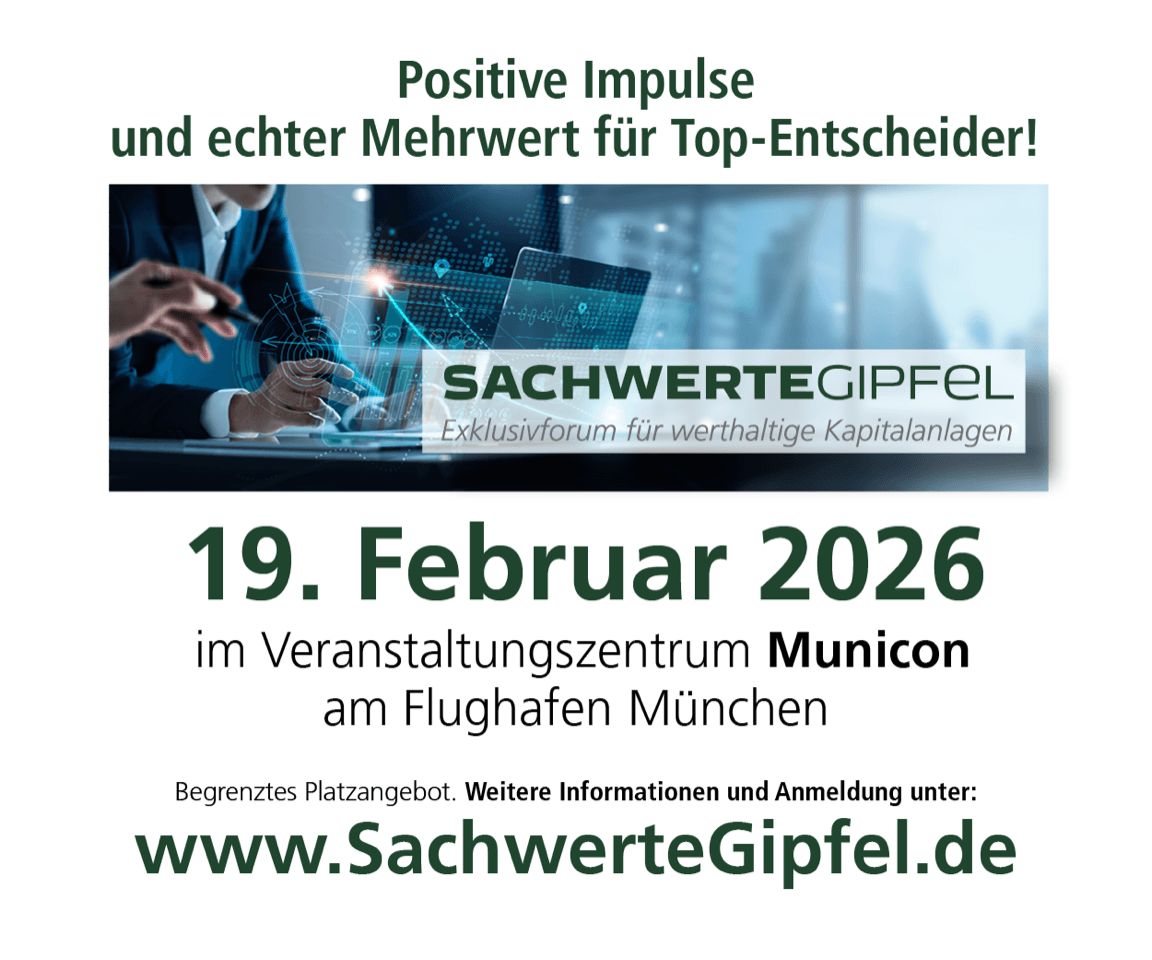Von der Warteschleife zum Voice Agent
20.11.2025

Geschäftsführerin Carolin Edler-Mende, Aristech GmbH / Foto: © A.Löffler FotoAgenten
Ein Kunde ruft an und möchte einen Schadensfall einreichen. Leider sind alle Leitungen belegt und ihm bleibt nichts anderes übrig, als minutenlang einer eintönigen Warteschleifenmusik zu lauschen. Zuvor klickt er sich noch im Tastenmenü durch, um mit der richtigen Abteilung verbunden zu werden. In einer Welt, in der ChatGPT alltäglich ist, wirkt eine Tonbandstimme mit Tastenmenü wie das Faxgerät des Kundenservice.
Das klingt frustrierend, ist aber für viele Versicherungskunden Alltag. Nicht alles lässt sich online erledigen, und nicht jeder möchte oder kann über das Internet mit seiner Versicherung kommunizieren. Dabei ist der technologische Sprung längst möglich. Versicherer investieren Millionen in die Digitalisierung, aber der erste Kundenkontakt ist nach wie vor oft analog. Dabei sind viele Kundinnen und Kunden heute an dialogfähige Systeme gewöhnt und bevorzugen sie sogar. Wenn sich eine Frage schnell und einfach über einen Chat- oder Voicebot lösen lässt, wählen nur noch rund 20 Prozent den menschlichen Kontakt, so die Erfahrung des Kommunikationsexperten Aristech. Das Problem ist also nicht die Technik, sondern die Vorstellung, was sie leisten darf.
Was heute schon möglich ist Was heute schon möglich ist
Die Systeme können heute weit mehr, als viele Entscheiderinnen und Entscheider vermuten. Moderne Voice Agents verstehen natürliche Sprache, identifizieren den Anrufer, führen durch ganze Prozesse und erledigen Routineaufgaben zuverlässig. Ein Beispiel: Ein Kunde meldet einen Kfz-Schaden. Der Bot fragt nach Unfallzeitpunkt, Ort, Beteiligten und ob Fotos des Schadens eingereicht werden können. Parallel erstellt er eine Vorgangsnummer, sendet einen sicheren Upload-Link per SMS und prüft automatisch, ob die Police den Schaden grundsätzlich abdeckt. Der Fall ist bereits dokumentiert, bevor ein Call-Center-Agent übernimmt. Wenn zusätzliche Informationen nötig sind, ruft der Bot gezielt zurück. Das lästige Hin und Her zwischen Hotline, Formularen und E-Mail entfällt.
Auch Standardaufgaben im Bestand lassen sich vollständig automatisieren. Will ein Kunde seine Adresse oder IBAN ändern oder eine Beitragsrechnung prüfen, kann der Bot ihn eindeutig identifizieren, etwa über Geburtsdatum und Postleitzahl, und den Vorgang direkt ins Bestandssystem eintragen. Gleiches gilt für Auskünfte: Laufzeiten, Raten, offene Dokumente oder Fälligkeiten werden in Echtzeit vorgelesen oder per E-Mail bestätigt. In der Praxis erledigen solche Systeme Hunderte Routineanliegen pro Tag, ohne dass ein Mitarbeitender eingreifen muss. Das schafft Freiraum für komplexere, beratungsintensive Gespräche. Durch derartige Technologien können Versicherer bis zu 80 Prozent ihrer Kundenkommunikation automatisieren.
Grenzen hat die Automatisierung dort, wo Ermessensspielraum oder Einfühlungsvermögen gefragt sind – etwa bei Leistungsablehnungen oder Beschwerden. Hier erkennt der Voicebot oder KI-Agent, dass die Anfrage sensibel ist, und übergibt das Gespräch samt aller bisherigen Informationen an eine reale Ansprechperson. Diese sieht sofort, wer anruft, worum es geht und welche Daten bereits verifiziert sind. Der Kunde muss nichts wiederholen. Das Ergebnis ist ein flüssiger Übergang zwischen Maschine und Mensch. Dadurch verkürzt sich der Zeitaufwand für Servicemitarbeitende um etwa 30 Prozent, weil alle relevanten Informationen bereits vorliegen.
Und: Die Systeme skalieren nach Bedarf. Sie arbeiten 24/7 und reagieren ohne Qualitätsverlust auf Montagmorgen-Spitzen oder Unwetterschäden.
Datenschutzbedenken und ROI
Auch wenn der Nutzen klar ist, bleiben bei vielen Versicherern Bedenken, insbesondere beim Datenschutz. Schließlich werden im Dialog hochsensible Kundendaten verarbeitet, und die Diskussion um „halluzinierende“ Sprachmodelle ist allgegenwärtig. Doch moderne Architekturen können das Risiko minimieren: Mehrere Sicherheits-Layer prüfen jede Ausgabe gegen definierte Kriterien, bevor sie an Kunden ausgespielt wird. Sprachmodelle lassen sich zudem On-Premises betreiben, sodass die Daten das Unternehmen nie verlassen. In Kombination mit regelbasierten Prüfmechanismen entstehen planbare und korrekte Antworten – Datenschutz und Sicherheit bleiben dabei Pflicht. Wer auf europäische Anbieter mit eigener Infrastruktur setzt, wie beispielsweise Aristech, kann DSGVO-konform und souverän agieren.
Viele Versicherer zögern auch wegen vermeintlich hoher Anfangsinvestitionen. In der Praxis ist der Einstieg jedoch deutlich einfacher geworden. Dank standardisierter Schnittstellen (APIs) lassen sich Bots heute schrittweise anbinden, zunächst an einfache Prozesse, später an komplexere Fachsysteme. Die Kosten entstehen weniger in der Technik als in der Priorisierung. Eine Callcenter-Minute kostet zwischen einem und drei Euro. Im First-Level Support kann ein Voicebot einen erheblichen Teil dieser Arbeit übernehmen. So amortisieren sich Investitionen oft schon nach einem halben Jahr.
Fazit
Der Wandel im Kundenservice ist kein Zukunftsszenario, denn er passiert bereits. Die Technologie ist da, die Akzeptanz ebenso. Jetzt geht es darum, sie klug einzusetzen: mit klaren Grenzen, souveräner Infrastruktur und einer Servicekultur, die Mensch und Maschine zusammendenkt. Die eigentliche Hürde ist nicht die Technologie, sondern der Mut, sie zuzulassen. (fw)

Altersvorsorge: Staatliche Fördergrenzen erhöht