Die Robo-Advisor-Revolution ist gescheitert
20.10.2025
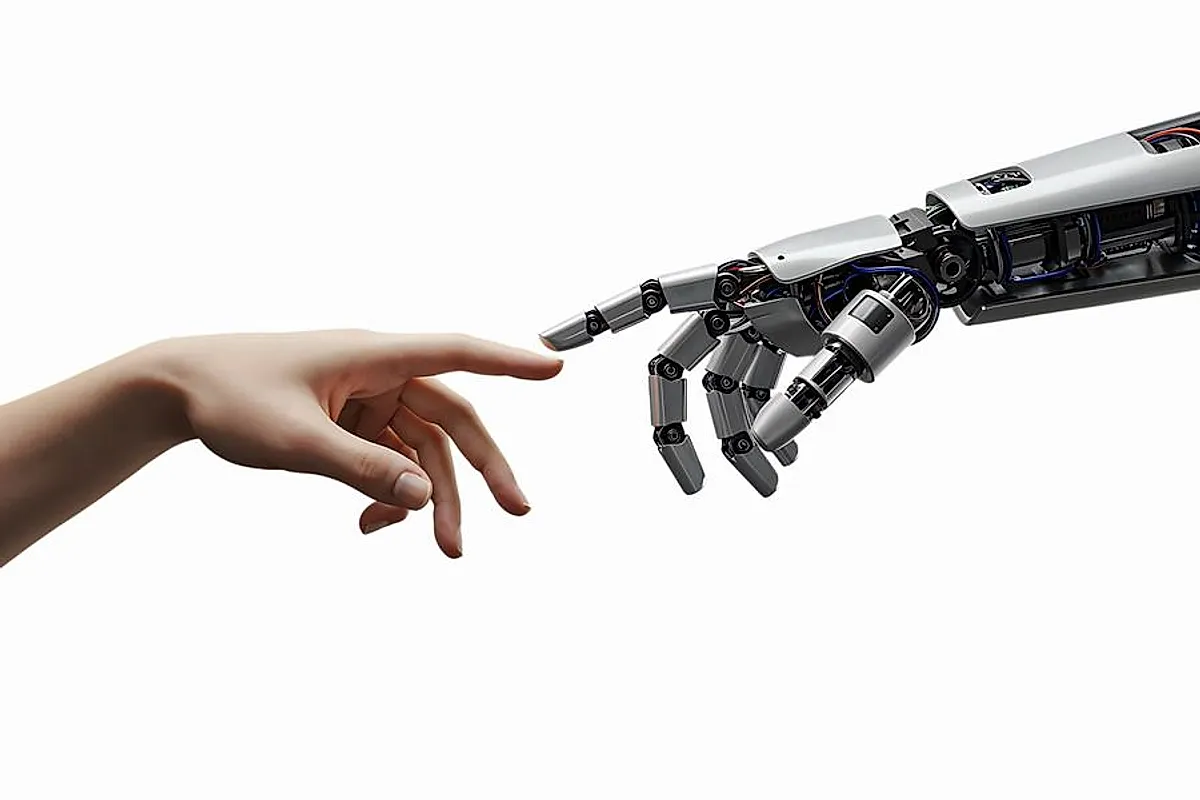
Foto: © moly - stock.adobe.com
Als Robo-Advisors vor rund zehn Jahren auf den Markt kamen, glaubte man, eine Revolution im Private Banking zu erleben: Wealth Manager fürchteten um ihre Erträge. Andere hofften, automatisierte Anlagestrategien würden das Kapitalanlagegeschäft demokratisieren und Vermögensaufbau effizienter machen. Was als disruptive Innovation begann, ist heute in einer Phase des Stillstands angelangt. Das liegt nicht an der Technologie, sondern an deren Umsetzung.
Der Begriff „Robo-Advisor“ suggeriert ein Leistungsversprechen, das der Realität nicht standhält. Von Beratung (Advisor) keine Spur. Stattdessen wurden Kunden meist in standardisierte ETF-Portfolios geschoben. Oft ohne jegliche Differenzierung und echtes Risikomanagement. Neobanken waren da ehrlicher. Kurz nach den Robos gestartet, setzten sie auf Selftrading zum Nulltarif und State-of-the-Art-Kundenerfahrung. Im direkten Vergleich verloren die Robos: Die Kundenbindung war schwach und die Robo-Technologie erlitt einen nachhaltigen Imageverlust – trotz ihres Potenzials.
Schlechte Performance und Einheitsbrei
Warum soll ich mein Geld bei einem Robo-Advisor anlegen? Selbst investieren bringt mehr! Oft stimmt das. Robos liefern weder überdurchschnittliche Rendite noch überzeugt ihr algorithmisches Risikomanagement. In volatilen Phasen reagieren sie oft zu träge. Gescheitert sind Robos nicht als Konzept, wohl aber als marktfähiges Produkt und eigenständiger Vertriebskanal. Statt intelligenter, datenbasierter Strategien boten sie algorithmische Stangenware. Ihre Entwickler verkannten, dass Wealth Management mehr ist als ETF-Bepreisung auf Autopilot. Im Fokus standen junge Menschen mit wenig Anlagevermögen oder Kunden, die erst damit begonnen hatten, ein Vermögen aufzubauen. Diese Zielgruppe brachte jedoch kaum Erträge, um die hohen Marketingausgaben über Online- und Offline-Kanäle zu rechtfertigen. Der erwartete Deckungsbeitrag blieb aus, die wirtschaftlichen Ergebnisse lagen deutlich unter den Prognosen. In der Folge mussten einige Anbieter ihre Aktivitäten deutlich zurückfahren oder den Markt ganz verlassen. Die Cost-Income-Ratio blieb in vielen Fällen dauerhaft negativ. Ein nachhaltiges Geschäftsmodell ließ sich so nicht etablieren.
Die wahre Zielgruppe finden
Kurzfristig orientierte DIY-Anleger, die Social Media und Neobroker bevorzugen, sind nicht die Zukunft. Der Hebel liegt bei vermögenden Kundinnen und Kunden über 40, die Stabilität, Langfristigkeit, Effizienz und funktionierendes Risikomanagement suchen. Für sie kann ein Robo-Advisor eine sinnvolle Ergänzung zur persönlichen Beratung sein; insbesondere, wenn er Künstliche Intelligenz nutzt, um Anlagestrategien zu differenzieren. Robo-Advisor ersetzen keine Beratung – zumindest noch nicht. Aktuell ergänzen sie die Beratung durch Experten. Richtig eingesetzt, sind sie digitale Vertriebs- und PortfoliomanagementTools, die Skalierung, Effizienz und Compliance verbessern. Wer das ignoriert, verschenkt strategisches Potenzial und Marktanteile. Für den neuen Hype im Robo-Advisor-Markt sorgt Künstliche Intelligenz. Sie ermöglicht deutlich präzisere Analysen und Prognosen als die regelbasierten Systeme. Insbesondere im Risikomanagement wird die KI den Menschen zunehmend ersetzen, weil sie Marktrisiken in Echtzeit erkennt und adaptiv reagiert.
Prognose bis Ende 2026
Rund 60 % der Robos der ersten Generation werden in den kommenden eineinhalb Jahren vom Markt verschwinden. Leise und ohne Aufsehen. Zurück bleiben enttäuschte Kunden, die nach aktienbasierten Anlagestrategien suchen. Hier liegt die Chance. Die Robo-Advisor der neuen Generation kommen mit einem neuem Narrativ, einer neuen Zielgruppenstrategie und mit deutlich höherem Anspruch an Qualität und Differenzierung. Die Zukunft gehört dem intelligenten Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Einerseits werden KI-basierte Robo-Advisor mit echten KI-Strategien und automatisiertem Portfoliomanagement den Markt dominieren. Hier werden sehr vermögende Kunden und sogar institutionelle Anleger wie Family Offices Differenzierungsstrategien fahren. Aber auch aktienaffine Selftrader, die großen Wert auf quantitatives Risikomanagement legen, werden margenstarkes Asset under Management bringen. Andererseits wird der Trend „Direct Indexing“ einen neuen Typ von Robo-Advisor entstehen lassen. Dabei werden für jeden Anleger einzelne Aktien entsprechend des gewählten Index im Depot gehalten und nicht wie bei ETFs ein gesamter Paketmantel gekauft. Das soll u. a. ManagementGebühren komplett einsparen. Direct Indexing erlaubt Anlegern, ihr Portfolio sehr flexibel zu gestalten. Wenn ein Kunde eine bestimmte Branche ablehnt oder einzelne Titel im Depot halten möchte, lässt sich dies gezielt steuern, ohne dass der Index-Ansatz insgesamt verloren geht.
Ein weiterer strategischer Vorteil liegt im sogenannten TaxLoss-Harvesting – dem gezielten Realisieren steuerlich relevanter Buchverluste. Konkret bedeutet das: Positionen, die im Minus stehen, werden verkauft, um den Verlust steuerlich nutzbar zu machen. Anschließend erwirbt man inhaltlich vergleichbare Titel. Dadurch bleibt die gewünschte Marktexponierung erhalten, ohne dass man gegen steuerliche Vorschriften zu verstößt. Dieses Verfahren ermöglicht es, Portfolios laufend steuerlich zu optimieren, ohne die strategische Ausrichtung zu verändern.
Der Robo-Advisor ist tot. Es lebe der Robo-Advisor! Die Zukunft gehört der digitalen Vermögensverwaltung, die Künstliche Intelligenz, personalisierte Anlagestrategien und steueroptimierte Strukturen nahtlos miteinander verbindet.
Ein Beitrag von Stefan Schmitt, Geschäftsführer, INNO INVEST GmbH

Votum: Notwendigkeit der parlamentarischen Korrektur









