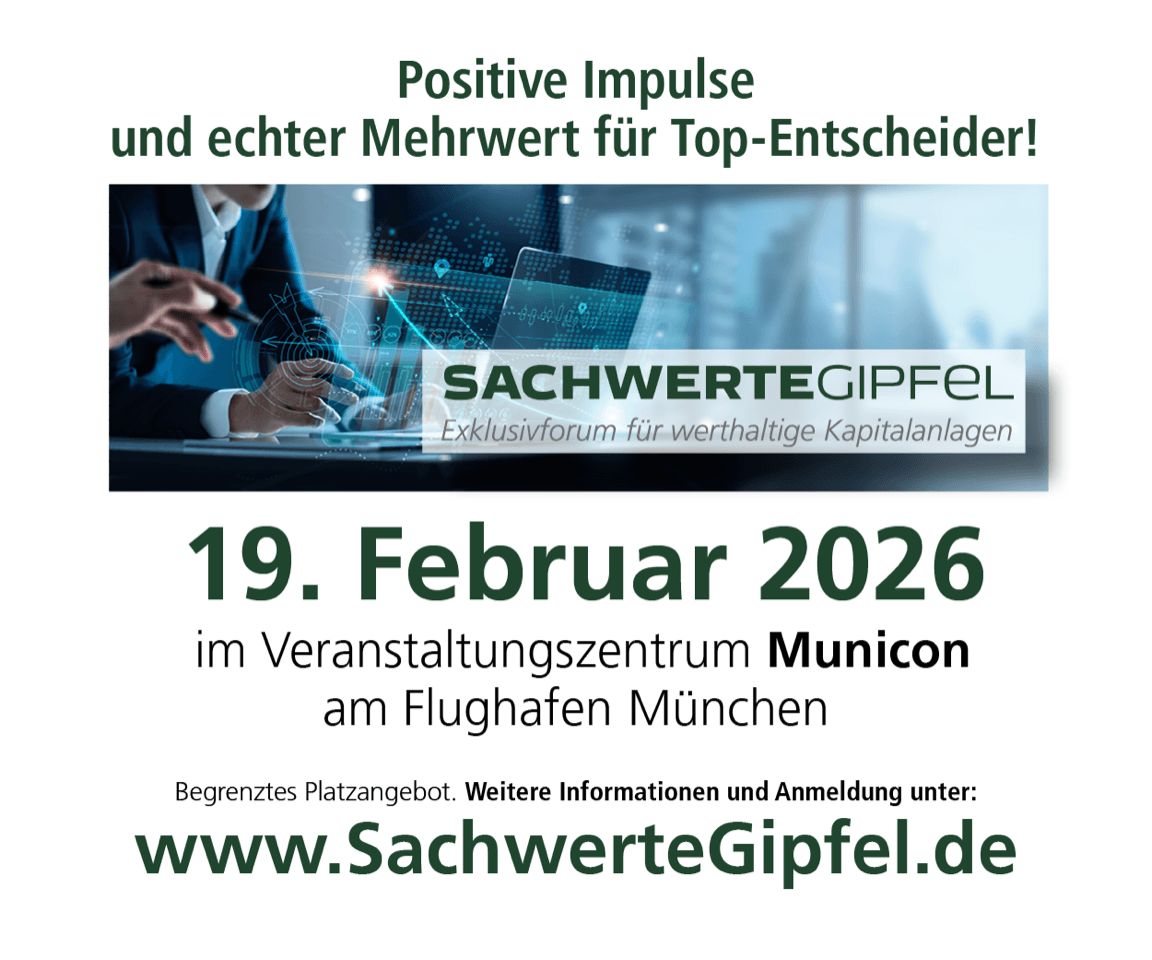Mentale Antifragilität – über den produktiven Umgang mit Stress und Unsicherheit
16.09.2025

Dr. Axel Breitbach. Foto: © privat
Ein Gespräch mit Dr. Axel Breitbach, promovierter Wirtschaftswissenschaftler (Sprecher der KfW-Ipex) und erfahrener Coach, über die Bedeutung von Antifragilität für Führungskräfte in der Finanzbranche.
fw: Viele Führungskräfte in der Finanzbranche berichten von zunehmender Belastung durch Stress, Unsicherheit und ständige Veränderungen. Was erschwert den konstruktiven Umgang damit?
Dr. Axel Breitbach: Der Grund liegt in der Art und Weise, wie unser Gehirn auf Stress reagiert. Es aktiviert evolutionär entwickelte neuronale Netzwerke – etwa Flucht oder Angriff. Diese Reaktionsmuster sind bei kurzfristiger Bedrohung sinnvoll, aber im modernen Arbeitsumfeld – geprägt von komplexen, dauerhaften Herausforderungen – führen sie schnell zu Erschöpfung.
Zudem haben viele Menschen gelernt, Stress zu vermeiden oder zu kompensieren. Das ist so, als würden wir niemals Sport treiben, um die Muskeln zu schonen. Denn Stress kann – richtig dosiert – ein wertvoller Trainingsreiz sein.
fw: Sie verwenden in diesem Zusammenhang den Begriff „Antifragilität“. Was unterscheidet diesen Ansatz von klassischer Resilienz?
Breitbach: Resilienz beschreibt die mentale Fähigkeit, Belastungen zu überstehen und anschließend wieder ein stabiles Niveau zu erreichen. Antifragilität geht darüber hinaus: hier wächst die mentale Belastbarkeit durch Unsicherheit, Druck und Störungen. In einem volatilen Umfeld wie der Finanzbranche ist das von großer Bedeutung. Wer sich nur bemüht, Rückschläge zu überstehen, bleibt reaktiv. Wer jedoch antifragil agiert, nutzt Veränderung aktiv zur Weiterentwicklung.
fw: Worin liegt aus Ihrer Sicht der konkrete Nutzen für Führungskräfte?
Breitbach: Die Finanzbranche ist geprägt von hoher Dynamik: Regulatorik, Digitalisierung, geopolitische Einflüsse, technologische Umbrüche – all das erzeugt stetigen Veränderungsdruck. Wer hier lediglich mentale Wiederherstellung anstrebt, läuft Gefahr, anpassungsschwach zu werden. Führungskräfte mit einem antifragilen Mindset betrachten Unsicherheit nicht primär als Risiko, sondern als Lernumgebung. Sie sind in der Lage, aus Krisen Strategien abzuleiten, wirksam für ihre Teams zu agieren und auch unter hoher Belastung handlungsfähig zu bleiben.
fw: Stützen wissenschaftliche Grundlagen den Ansatz der Antifragilität?
Breitbach: Die Neurowissenschaften zeigen, dass unser Gehirn bis ins hohe Alter lern- und anpassungsfähig bleibt – vorausgesetzt, es wird entsprechend herausgefordert. Ein zentrales Modell – aus der Positive Psychologie kommend – ist hier das sogenannte broaden-andbuild-Prinzip: Positive emotionale Erfahrungen erweitern unser Wahrnehmungsspektrum und fördern langfristig neue Denk- und Handlungsmuster – auch im Umgang mit Stress.
fw: Als erfahrener Triathlontrainer können Sie gut Parallelen zum Sport ziehen. Was lässt sich daraus konkret für mentale Stärke ableiten?
Breitbach: Im Sport spricht man von Superkompensation: Eine sinnvolle Regeneration nach einer Belastung führt dazu, dass der Körper seine Leistungsfähigkeit über die ursprüngliche hinaus steigert. Übertragen auf den mentalen Bereich heißt das: Wer sich gezielt mit moderaten Belastungen auseinandersetzt – z. B. in anspruchsvollen Gesprächssituationen oder unter Zeitdruck – und anschließend reflektiert und dabei analysiert, was funktioniert hat, trainiert seine mentale Anpassungsfähigkeit. Entscheidend ist dabei – wie auch im Sport – die Dosis und die bewusste Reflexion, also das Erkennen eigener funktionierender Strategien.
fw: Wie könnte so ein Trainingsprozess konkret aussehen?
Breitbach: Dabei sollte jeder sehr individuell herangehen. Entscheidend ist, persönliche Stressoren zu identifizieren – also zunächst Situationen auflisten, in denen man unter Druck gerät. Anschließend geht es darum, diesen gezielt in kleinen Schritten zu begegnen. Beispielsweise kann jemand, der sich in wichtigen, großen Präsentationen unter Stress gesetzt fühlt, beginnen, regelmäßig in kleineren Meetings das Wort zu ergreifen.
Wichtig ist die anschließende Reflexion: Was hat mir persönlich geholfen, was nicht? Welche innere oder äußere Unterstützung war hilfreich? So lassen sich eigene Handlungsspielräume erweitern. Entscheidend ist auch hier das Individuelle der Lösungsstrategien – was bei anderen hilft, hilft mir vielleicht nicht und umgekehrt.
fw: Welche Entwicklungen beobachten Sie bei Führungskräften, die sich aktiv mit Antifragilität auseinandersetzen?
Breitbach: Viele berichten, dass sich ihre innere Haltung verändert – nicht, weil externe Belastungen geringer würden, sondern weil sich ihr Umgang damit verbessert, weil man neue Strategien und Ressourcen hinzugewinnt.
Ein Beispiel: Eine Führungskraft, die ich begleitet habe, sah in einer organisatorischen Umstrukturierung zunächst eine Bedrohung. Durch gezielte Auseinandersetzung mit ähnlichen, weniger kritischen Situation war es ihr zunächst möglich, einen konstruktiven Blick auf die Veränderung einzunehmen. In der Folge gelang es ihr, neue Rollen im Team zu gestalten, Prozesse effizienter aufzustellen und die Zusammenarbeit zu stärken. Das hat nicht nur ihre persönlich wahrgenommene Belastung reduziert, sondern auch die Resilienz der Abteilung erhöht.
fw: Mentale Stärke wird oft mit „Härte“ verwechselt. Was unterscheidet Antifragilität hier?
Breitbach: Härte“ im klassischen Sinne – also das Aushalten um jeden Preis – kann kurzfristig funktionieren, führt langfristig aber zu Verschleiß. Antifragilität hingegen setzt auf Beweglichkeit. Sie basiert auf dem Verständnis, dass Belastung nicht nur vermieden, sondern bewusst genutzt werden kann – ohne Überforderung zu riskieren. Gesünder ist dieser Ansatz, weil er auf Entwicklung statt Abwehr abzielt. Er fördert nachhaltige Leistungsfähigkeit, ohne mentale Erschöpfung zu provozieren.
fw: Was wäre ein erster, umsetzbarer Schritt für Fach- und Führungskräfte in der Finanzbranche, die sich dem Thema annähern möchten?
Breitbach: Ein erster wichtiger Schritt ist die gezielte Selbstbeobachtung: In welchen Situationen entsteht bei mir Druck? Welche Reaktion folgt?
Dann gilt es, eine bewältigbare Konfrontation mit diesem Stressor zu wählen. Wer etwa mit Unsicherheit in Kundengesprächen ringt, kann sich gezielt Gesprächssituationen aussetzen, die zwar auch als herausfordernd, aber gerade noch machbar eingeschätzt werden. Anschließend heißt es, sich selbst zu reflektieren und daraus Lösungsstrategien zu entwickeln. Ähnlich wie bei Sport müssen sich daraus Routinen entwickeln, denn Muskeln wachsen ja auch nicht durch einmaliges, sondern nur durch regelmäßiges Training. Hilfreich ist dabei ein externer Sparringspartner – sei es durch Coaching oder im kollegialen Austausch –, um den Reflexionsprozess zu begleiten, die Perspektive zu erweitern und den Lernprozess zu beschleunigen. (fw)

Hochwertige Geräte von Emco aus zweiter Hand