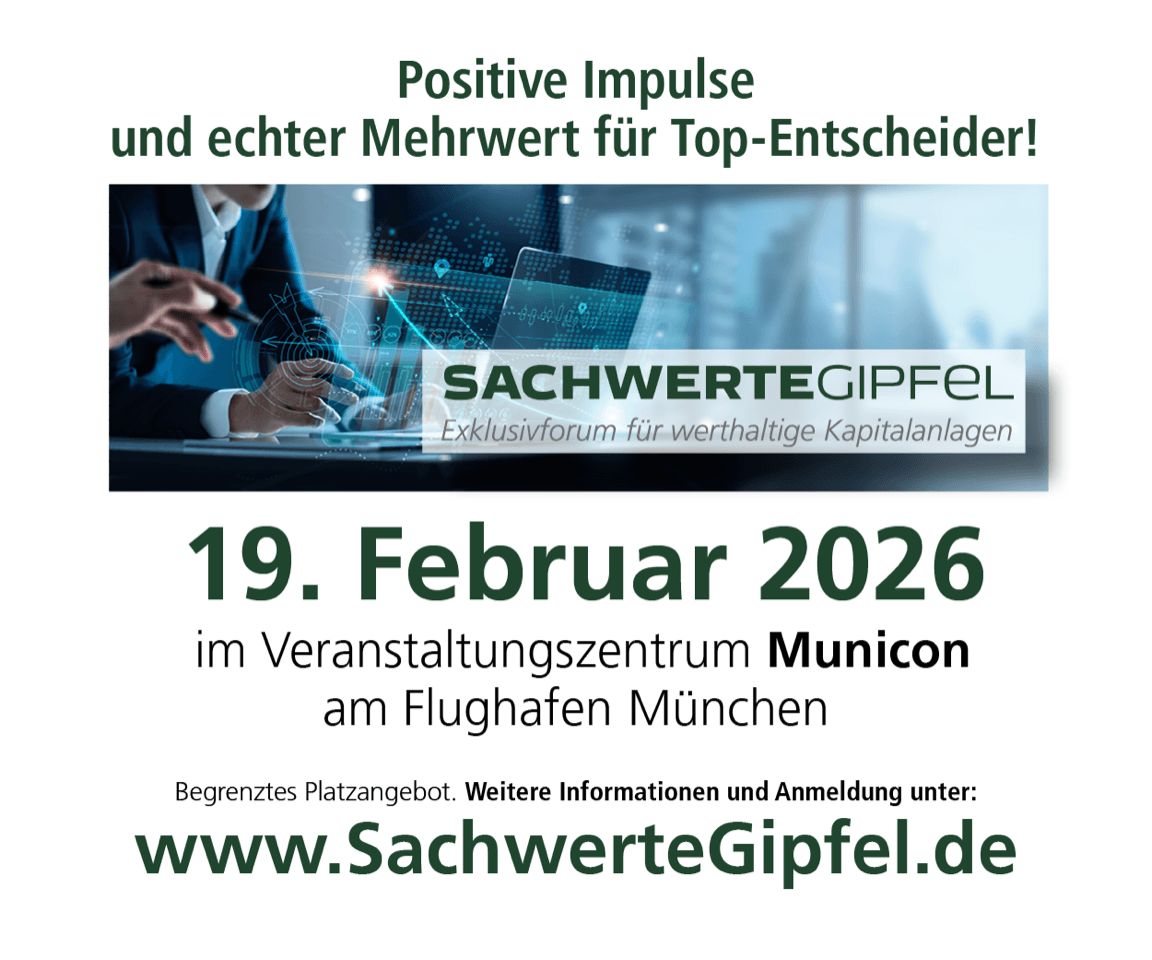Öl – die missverstandene Realität
18.09.2025

Foto: © Anto - AI - stock.adobe.com
Öl gilt für viele als Auslaufmodell – überholt von Elektromobilität und erneuerbaren Energien, diskreditiert durch die Klimadebatte. Doch die fundamentale Marktlage erzählt eine andere Geschichte.
Wer zurückblickt, erkennt Parallelen: Ende der 1990er-Jahre galt Gold als „barbarisches Relikt“. Zentralbanken verkauften hektisch ihre Bestände, Analysten erklärten das Ende der Relevanz. Der Preis stürzte um 70 Prozent. Doch genau in dieser Phase begann eine der stärksten Hausse des Rohstoffs – Gold wurde zum erfolgreichsten Investment der 2000er-Jahre. Heute steht Öl an einem ähnlichen Wendepunkt.
Fehlannahme 1: Der Markt ist im Überschuss
Die Internationale Energieagentur (IEA) meldete für das erste Halbjahr 2025 ein Überangebot von 1,2 Millionen Barrel pro Tag. Formal basiert diese Rechnung auf einer Nachfrage bei der OPEC von 26,5 Millionen Barrel täglich bei einer tatsächlichen OPEC-Produktion von 27,75 Millionen Barrel.
Auffallend allerdings: Statt gut gefüllt zu sein, sind die kommerziellen Lagerbestände im selben Zeitraum um rund 10 Millionen Barrel gesunken. Eine unangenehme Tatsache für die IEA, die diese Differenz in ihrer Bilanz aktuell noch in der Kategorie „Verschiedenes“ aufführt. In der Vergangenheit haben derartige Einordnungen jedoch immer zu einer späteren Korrektur geführt und waren ein Eingeständnis, dass die Nachfrage in den Berechnungen unterschätzt wurde. Lässt man die Rechnung der IEA außer Acht, haben sich die weltweiten Lagerbestände seit 2022 kaum verändert: Die kommerziellen Lagerbestände sind um 10 Millionen Barrel gesunken, die staatlichen Reserven um neun Millionen Barrel gestiegen. Folglich ist der Markt nicht im Überschuss, sondern vielmehr ausgeglichen.
Fehlannahme 2: Die Nachfrage wächst schwach
Laut IEA stieg der globale Verbrauch im ersten Halbjahr 2025 nur um 900.000 Barrel täglich. Das Bild ändert sich jedoch, wenn die nicht verbuchten Mengen berücksichtigt werden: Tatsächlich lag das Wachstum bei 2,1 Millionen Barrel – also mehr als doppelt so hoch. Zudem ist die Dynamik nicht schwächer, sondern stärker geworden: von 1,4 Millionen Barrel Zuwachs im ersten Quartal auf 2,7 Millionen im zweiten. Anstatt zu erlahmen, beschleunigt die Nachfrage.
Fehlannahme 3: Die Nachfrage bleibt schwach
Für das Gesamtjahr 2025 prognostiziert die IEA lediglich ein Plus von 600.000 Barrel, 2026 sollen es 700.000 sein. Doch mit der Korrektur durch die „fehlenden Barrel“ liegt die Realität höher: Schon 2025 dürfte die Nachfrage bei rund 104,8 Millionen Barrel pro Tag liegen – ein Zuwachs von 1,8 Millionen Barrel. Für 2026 erscheint ein Wert von fast 106 Millionen Barrel realistisch, also rund 1,6 Millionen mehr als im Konsens. Die Vorstellung einer dauerhaft schwachen Nachfrage steht damit auf wackligen Füßen.
Fehlannahme 4: Nicht-OPEC-Angebot steigt deutlich
Neue Offshore-Projekte in Guyana, Brasilien und Suriname sollen ab 2025 jährlich rund 750.000 Barrel zusätzlich liefern. Doch diese Bruttomengen verschleiern die Realität der Förderprofile.
Historisch liegt der jährliche Rückgang bestehender Felder bei rund 1 Million Barrel pro Tag, was die Nettozuwächse drastisch schmälert. Zwischen 2017 und 2024 fügten Nicht-OPEC-Großprojekte außerhalb der USA im Schnitt 950.000 Barrel hinzu. Im gleichen Zeitraum sank das Angebot dieser Projekte jedoch tatsächlich um 100.000 Barrel. Um das von der IEA erwartete Netto-Plus zu erreichen, müsste der natürliche Rückgang plötzlich halbiert werden – ein Szenario, das geologisch kaum plausibel ist. Zudem fehlen ab 2026 weitere große Projekte, was das Potenzial für künftige Angebotsausweitungen weiter reduziert. Wir haben diesen Fehler schon einmal gesehen – Analysten prognostizieren Bruttozugänge und vergessen dabei, dass alte Bohrlöcher altern und versiegen.
Fehlannahme 5: Elektroautos bremsen den Ölbedarf
Das Standardnarrativ lautet: Bis 2030 verdrängen Elektroautos den Verbrenner und drücken das Öl-Wachstum auf nur noch 250.000 Barrel pro Tag. Doch außerhalb Chinas haben sich die Erwartungen abgekühlt. Während batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) zwischen 2021 und 2023 noch um 50 Prozent jährlich zulegten, liegt das Wachstum seitdem nur noch bei etwa fünf Prozent. Ganz anders Plug-in-Hybride, die weiterhin mit fast 40 Prozent pro Jahr steigen. Viele Konsumenten sehen in ihnen den praktikableren Kompromiss. Hinzu kommen physikalische Faktoren: Rechnet man Herstellung und Energieaufwand ein, sind BEVs bis zu 40 Prozent weniger effizient als klassische Verbrenner – Hybride dagegen effizienter. Dennoch prognostizieren Analysten, dass das Wachstum bei BEVs bis 2035 wieder auf 33 Prozent pro Jahr ansteigen wird, selbst wenn sich das Wachstum bei Hybridfahrzeugen verlangsamt. Wir sind uns da nicht so sicher.
Fehlannahme 6: US-Schieferöl wächst weiter
Lange Zeit galten die US-Schieferölfelder als Garant für unbegrenztes Angebot. Noch 2023 erwarteten IEA und US-Energiebehörde ein Wachstum bis weit in die 2030er. Heute gehen beide Institute von einem Peak in 2026 aus. Unsere Modelle verorten den Höhepunkt bereits 2025/26. Das Permbecken, das letzte noch wachsende Feld, dürfte im Oktober 2024 seinen Höchststand erreicht haben. Erfahrungsgemäß folgt auf den Gipfel ein steiler Abstieg: In anderen Schieferölregionen sanken die Fördermengen binnen fünf Jahren um 30–50 Prozent. Wahrscheinlicher als ein Plateau ist deshalb ein Rückgang um 200.000 bis 300.000 Barrel pro Jahr.
Ölmarkt mit guten Chancen auf einen Bullenmarkt
Die verbreitete Annahme einer strukturellen Ölschwemme erweist sich als Trugschluss. Die globalen Lagerbestände sind stabil, die Nachfrage erweist sich als robuster als prognostiziert, die Produktionsausweitung außerhalb der OPEC ist fragiler als angenommen, und die USSchieferölförderung steht vor ihrem Zenit. Genau wie Gold um die Jahrtausendwende könnte Öl in den kommenden Jahren eine Trendwende erleben – entgegen dem Marktkonsens und zur Überraschung vieler Anleger. Für Investoren bedeutet dies: Der nächste Bullenmarkt im Energiesektor könnte bereits an der Schwelle stehen.
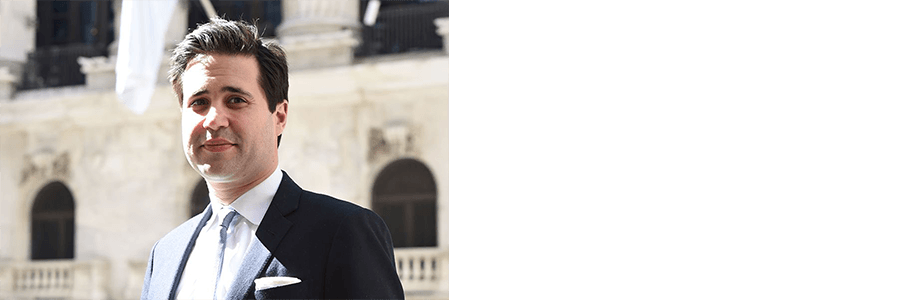
Marktkommentar von Adam Rozencwajg, CEO von Goehring & Rozencwajg.

Alle Gesellschaften der BTS Finance Group auf der Erfolgsspur