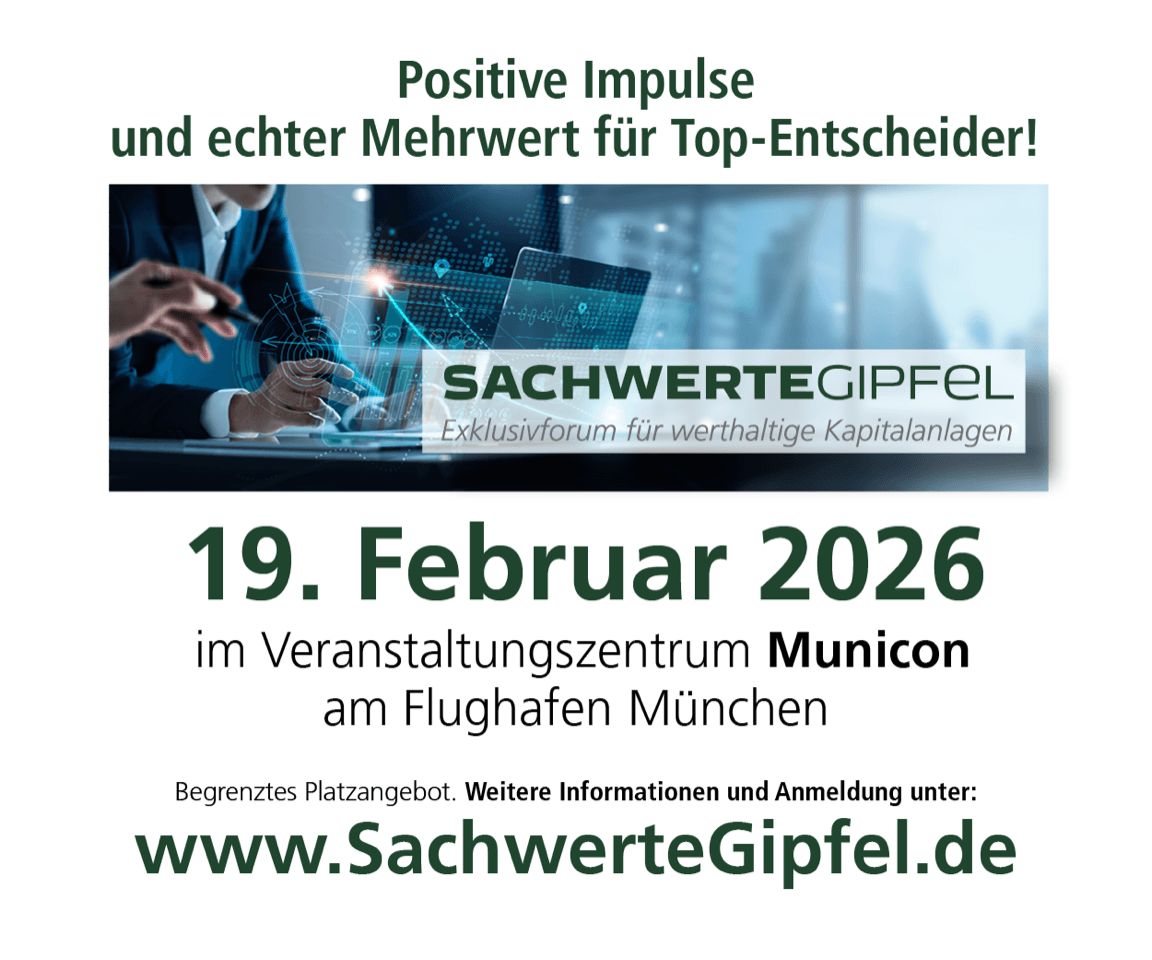Vom Tennisplatz ins Management: Die Karriere von Sören Friemel
31.10.2025

Foto: © Mikael Damkier - stock.adobe.com
Die besten Führungskräfte beginnen oft als besessene Schülerinnen und Schüler ihres Fachs. In Münster nannte ein Tennistrainer seinen 17-jährigen Schüler einmal einen „Korinthenkacker" – jemanden, der es mit den Details sehr genau nimmt. Der junge Spieler hatte die Angewohnheit, im Training alles zu hinterfragen, besonders wenn es um Regeln und technische Aspekte ging. Statt dies als Problem zu sehen, erkannte der Trainer das Potenzial. „Die suchen Schiedsrichter", schlug er vor. „Hast du nicht Lust, das mal zu probieren?"
Diese Eigenschaft – akribische Liebe zum Detail, Respekt vor Prozessen, kompromissloser Fokus auf Korrektheit – wurde zum Fundament einer globalen Karriere in der Sportführung. Sören Friemels Weg von den Münsteraner Tennisplätzen zum ITF Head of Officiating und US Open Referee zeigt: Authentische Führung entsteht nicht allein aus Ehrgeiz. Sie entwickelt sich durch die Beherrschung der Grundlagen, durch das Annehmen von Komplexität, die andere meiden würden, und durch niemals kompromittierte Prinzipien – selbst wenn deren Anwendung erhebliche Kosten verursacht. Dies ist keine klassische Erfolgsgeschichte. Es ist eine Studie darüber, wie Prinzipien sich über Jahrzehnte potenzieren und Türen öffnen, von denen man nicht wusste, dass sie existieren.
Warum die Beherrschung der Grundlagen unerwartete Türen öffnet
Die Lehrjahre begannen unspektakulär bei lokalen Turnieren in Münster. Kein Glamour, keine internationalen Reisen – nur das stille Lernen durch Erfahrung, Match für Match. Das erste internationale Match kam schnell – vielleicht zu schnell. Nach einem anderthalbstündigen Crashkurs über Spielberichtsbögen und grundlegende Abläufe saß der jugendliche Offizielle plötzlich auf dem Stuhl bei seinem ersten Profimatch. Der Oberschiedsrichter stand den ganzen ersten Satz neben dem Stuhl, „weil er keine Ahnung hatte, was für eine Plinze da oben sitzt." Rückblickend bringt die Erinnerung sowohl Humor als auch Demut: „Ich sah aus wie ein gerupftes Hühnchen da oben."
Diese frühe Erfahrung, in Situationen geworfen zu werden, die leicht über der aktuellen Fähigkeit lagen, Fehler vor Menschen zu machen, die es besser wussten zu lernen, dass Vorbereitung zählt - aber Erfahrung noch mehr, das bildete das Fundament. Es gibt keine Abkürzungen zur Glaubwürdigkeit im Schiedsrichterwesen. Entweder kennt man die Regeln und kann sie unter Druck anwenden, oder nicht. Das Publikum, seien es SpielerInnen oder KollegInnen, erkennt den Unterschied sofort.
Die Jahre von 1994 bis 2000 bedeuteten, auf allen Ebenen des professionellen Tennis zu arbeiten. Kleine Challenger-Turniere in deutschen Städten, wo die Vergütung kaum die Spesen deckte. WTA-Events in europäischen Metropolen. ATP-Tour-Stopps. Schließlich alle vier Grand Slams. Die Versuchung besteht, kleinere Events als geringwertige Aufträge zu behandeln – als Sprungbretter zu etwas Besserem. Sören Friemel entwickelte früh ein anderes Prinzip: „Eine kleine regionale Veranstaltung verdient dieselbe Professionalität wie ein Grand Slam." Das war kein Altruismus, sondern Strategie. Der Ruf im Schiedsrichterwesen kommt von Beständigkeit über Kontexte hinweg. SpielerInnen, Supervisoren und KollegInnen bemerken, wer Standards unabhängig von den Umständen aufrechterhält und wer den Einsatz nach Turnierprestige anpasst.
Parallel zum Tennis gab es Basketball. Als Schiedsrichter in regionalen Basketballligen zu fungieren mag wie ein Umweg erscheinen, aber es lehrte entscheidende Lektionen über Präsenz und Autorität. Basketball-Schiedsrichterei ist unmittelbar und konfrontativ auf Weise, wie es Tennis nicht ist. Man trifft Entscheidungen zentimeternah an SpielerInnen und Coaches und bewältigt ständige Anfechtungen des eigenen Urteils. Die Lektion kristallisierte sich heraus: Selbstbewusste Präsenz kombiniert mit Regelkenntnis schafft Autorität. Ist man bei einem der beiden unsicher, spüren es die Leute sofort. Ist man bei beiden selbstsicher, gebieten selbst kontroverse Entscheidungen Respekt.
Der Schwenk vom Einzelkämpfer zum Teamentwickler kam durch die Verantwortung bei den Gerry Weber Open in Halle, dem prestigeträchtigen Rasenturnier der ATP in Deutschland. Die Koordination von 150 Ballkindern und LinienrichterInnen klingt nach Logistik, wurde aber zur Ausbildung in Talententwicklung. Entwicklungspfade schaffen, wo Ballkinder LinienrichterInnen werden konnten, LinienrichterInnen zu StuhlschiedsrichterInnen aufsteigen konnten und junge Offizielle Mentoring erhielten, das ihren Fortschritt beschleunigte. Ein Ballkind, das in Halle begann, Timo Janssen, wurde schließlich einer von weltweit nur 32 Gold-Badge-SchiedsrichterInnen – die höchste Zertifizierung im Tennis-Schiedsrichterwesen. Aber auch für die deutschen Gold-Badge-SchiedsrichterInnen Nico Helwerth aus Stuttgart und Miriam Bley aus Würzburg war das Turnier in Halle eine wichtige Karrierestation und sie konnten vom Mentoring profitieren.
Dies offenbarte eine Kernerkenntnis: Das Vermächtnis ist nicht, was man persönlich erreicht. Es ist, wen man entwickelt und was diese Menschen dann erreichen. Die in Halle ausgebildeten Offiziellen arbeiten heute bei Grand Slams weltweit. Die geschaffenen Systeme für Training und Bewertung beeinflussten nationale und internationale Schiedsrichterstandards. Dieser Wechsel vom Ausführen der Arbeit zum Aufbau von Systemen, die andere befähigen, repräsentiert entscheidende Karriereevolution, die viele Menschen verpassen.
Im Jahr 2000 reifte eine Erkenntnis: „Meine Stärken liegen eher im organisatorischen Bereich." Selbstwahrnehmung über den komparativen Vorteil ist enorm wichtig in der Karriereentwicklung. Gut in etwas zu sein bedeutet nicht, dass es der eigene wertvollste Beitrag ist. Der Wechsel vom Stuhlschiedsrichter zu Supervisor- und Governance-Rollen repräsentierte diese Erkenntnis. Es gab sogar einen kurzen Aufenthalt beim CHIO Aachen, dem weltweit führenden Reitturnier, in der Turnierorganisation. Die Einsicht: Führungsprinzipien übertragen sich über Sportarten und Branchen hinweg.
Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite

Deutschland soll Technologieführerschaft übernehmen