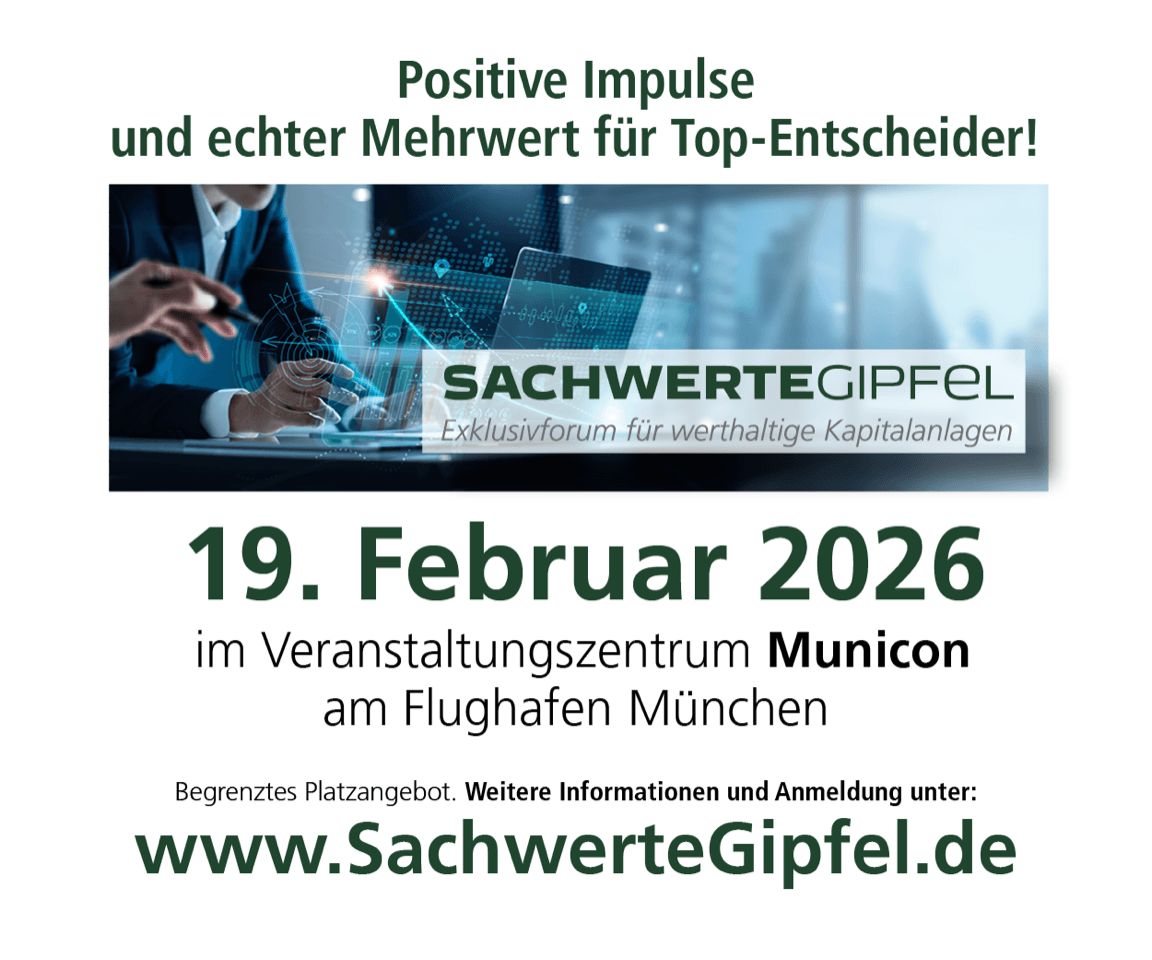Frühstartrente – Booster für die Altersvorsorge?
27.10.2025

Foto: © Jürgen Fächle - stock.adobe.com
Die Altersvorsorge in Deutschland ist reformbedürftig. Die Zahl der Steuer- und Beitragszahler sinkt, während die der Rentner und Pensionäre steigt. Leistungsanpassungen in der gesetzlichen Rentenversicherung sind hinsichtlich Beitragshöhe, Beitragszahlungsdauer und Ablaufleistung eigentlich nicht zu vermeiden, aber bei Wählern unbeliebt.
Bei echten Reformen ist man daher zögerlich. Mit der Ausweitung der Mütterrente steuert man eher noch in die falsche Richtung. Neben der „Aktivrente“ ist die „Frühstartrente“ ein weiteres rentenpolitisches Projekt. Jedes Kind und jeder Jugendliche im Alter zwischen sechs und 18 Jahren soll vom Staat monatlich zehn Euro erhalten, die in ein kapitalgedecktes Altersvorsorgesystem auf einem Konto angespart werden. Das Konto soll ab dem 18. Lebensjahr einen Grundstock für die Altersvorsorge bilden. Die Jugendlichen können dort weitere Beträge ansparen. Die Erträge sollen während der Ansparphase nicht besteuert werden, sondern erst bei Auszahlung – frühestens mit dem Erreichen der Regelaltersgrenze.
Positive Effekte
Aus einem solchen Konzept können hohe langfristige Renditen entstehen. Außerdem kann die allgemeine Finanzbildung verbessert werden, da man sich „zwangsweise“ über einen langen Zeitraum mit der eigenen Altersvorsorge beschäftigen müsste. Da auf das angesparte Kapital erst im Rentenalter zurückgegriffen werden kann, besteht eine starke sozialpolitische Motivation. Probleme gibt es jedoch bei der sozialen Gerechtigkeit und der Ausgestaltung – insbesondere im Falle einer begrenzten Inanspruchnahme durch einkommensschwache Haushalte über die staatlich finanzierte Ansparzeit hinaus.
Herausforderungen und offene Fragen
Zu den Herausforderungen gehören die Produktauswahl, die Kostenkontrolle, die Grundeinstellungen (Ausstiegs- und Umschichtungsoptionen), regulatorische Vorgaben und die Verhaltensanreize für nachhaltiges Sparen. Bei der Ausgestaltung gibt es noch einiges abzustimmen:
- Soll für jedes Kind ein Depot durch den Staat eröffnet werden, und zahlt dieser dann automatisch auf ein Konto oder in ein bestimmtes Produkt ein?
- Erfolgt die staatliche Einzahlung nur auf Antrag?
- Wird ein fixer Starttermin gewählt, oder werden auch Depots für zu diesem Zeitpunkt ältere Kinder eröffnet, für die dann zeitlich anteilig ein Ansparen erfolgt?
- Der Koalitionsvertrag sieht eine privatwirtschaftliche Organisation vor – warum also kein Staatsfonds (wie KENFO in Deutschland oder der AP7-Fonds in Schweden)?
- Gibt es Vorgaben für Anlageklassen, Diversifikation und Risikomanagement?
- Gibt es Begrenzungen bei Kosten oder Gebühren?
- Müssen die Vorsorgeprodukte einen Zertifizierungsprozess durchlaufen?
- Wie wird die Auszahlphase gestaltet (Teilauszahlung, garantierte Verrentung oder Auszahlplan ohne Garantie) und besteuert?
- Ist eine Vererbung möglich?
Staatlicher Fonds als Option
In dem Entwurf ist von privatwirtschaftlich organisierten Anlagen die Rede. Die Finanzbranche ist sich weitgehend einig und kommuniziert, dass staatlich gemanagte Produkte nicht offeriert werden sollten. Ich bin der Meinung, dass auch ein staatlich gemanagter Fonds angeboten werden sollte. Das Team, das den KENFO-Fonds managt, beweist seit acht Jahren, dass das funktioniert, und erzielt Renditen von 6,80 Prozent jährlich – derzeit über denen des norwegischen Staatsfonds und auch einiger bekannter amerikanischer Adressen. Als Altersvorsorgeprodukt müsste die Portfoliostruktur sicherlich angepasst werden. Außerdem können die Kosten bei staatlich gemanagten Produkten sehr niedrig sein. Der schwedische AP7-Fonds, der aus zwei Unterfonds besteht, hat beispielsweise jährliche Kosten von nur 0,11 Prozent und ist mit einer durchschnittlichen Rendite von etwa zehn Prozent seit Auflegung im Jahr 2000 ebenfalls sehr leistungsstark. Diese Produkte könnten auch automatisch eingesetzt werden, falls die Begünstigten keine Entscheidung treffen.
Besteuerung und Optionen in der Auszahlphase offen
Während man in der Ansparphase keine Steuern erheben will, ist die Auszahlphase noch nicht reguliert. Hier wäre auch eine Besteuerung nach dem individuellen progressiven Einkommensteuersatz denkbar – der Grenzsteuersatz liegt aktuell bei maximal 45 Prozent plus Solidaritätszuschlag. Dieses Vorgehen wäre sozial ausgewogener als eine Versteuerung der Kapitalerträge über die Abgeltungsteuer. Die Günstigerprüfung bei der Abgeltungsteuer ermöglicht es Steuerpflichtigen allerdings, ihre Kapitalerträge im Rahmen der Einkommensteuererklärung mit dem individuellen Einkommensteuersatz zu versteuern, wenn dieser unter dem pauschalen Abgeltungssteuersatz von 25 Prozent liegt.
Eine Option wäre auch ein zusätzlicher Sonderausgabenabzug nach § 10a EStG in der Ansparphase. Dies entspräche den Plänen der Ampel-Regierung zur Reform der RiesterRente. Neben den bisher verwendeten Garantien und lebenslangen Auszahlungen in Form von Versicherungslösungen wird im Kontext der Riester-Rente auch von der Fokusgruppe „Private Altersvorsorge“ die Variante eines Auszahlplans ohne Garantien gefordert. Dabei bliebe das Kapital der Person erhalten. Der Anbieter (zum Beispiel eine Bank oder Fondsgesellschaft) würde regelmäßige Raten so lange auszahlen, bis das Kapital aufgebraucht ist. Eine Garantie auf eine lebenslange Auszahlung gibt es daher nicht; ein nach dem Tod verbleibendes Restkapital könnte jedoch vererbt werden.
Fazit
Mit Blick auf das schwächelnde Riester-System und die Anfangsphase der schwedischen Prämienrente sollte verhindert werden, dass ungeeignete und überteuerte Finanzprodukte die Rendite der Frühstartrente schmälern. Bereits jetzt findet man auf den Internetseiten von Finanzunternehmen entsprechendes Marketing. Immerhin werden Kreditinstitute ab dem nächsten Jahr die Kontoeröffnung für Minderjährige etwas vereinfachen. Außerdem braucht man eine Strategie, mit der Menschen dazu bewegt werden, über das 18. Lebensjahr hinaus selbstständig weiterzusparen.
Grundsätzlich sollte es auch darum gehen, dass Eltern motiviert werden, einen solchen Vertrag für ihre Kinder mit Eigenmitteln aufzustocken. Bei Erziehungsberechtigten, die dazu in der Lage sind, müsste man sich allerdings die Frage stellen, warum man das nicht ohne staatliche Alimentierung hinbekommt. Die Anlageformen, die dafür infrage kommen, gibt es schließlich schon seit Jahrzehnten.
Das Argument „Steuerbefreiung in der Ansparphase“ zieht in Bezug auf Minderjährige nur bedingt. Hier kann man bereits jetzt unter aktiver Ausnutzung des Freistellungsauftrags oder – besser noch – mit einer Nichtveranlagungsbescheinigung Steuerabzüge vermeiden. Wenn man es ernst meint und den Zinseszinseffekt optimieren will, sollte ein solches Projekt idealerweise mit der Geburt starten. In dem Moment, in dem die Steuer-ID vergeben wird, sollte eine Entscheidung getroffen werden, wie der Betrag zunächst anzulegen ist. Wird keine Entscheidung getroffen, wird zunächst in einen Staatsfonds investiert.
Mit Blick auf das Ziel der Altersvorsorge müssen darüber hinaus zwingend die Auszahlphase und die Frage der Besteuerung strukturiert werden. Angesichts der Vielzahl offener Fragen scheint es jedoch unwahrscheinlich, dass die „Frühstartrente“, wie ursprünglich angedacht, bereits im Januar 2026 an den Start geht.
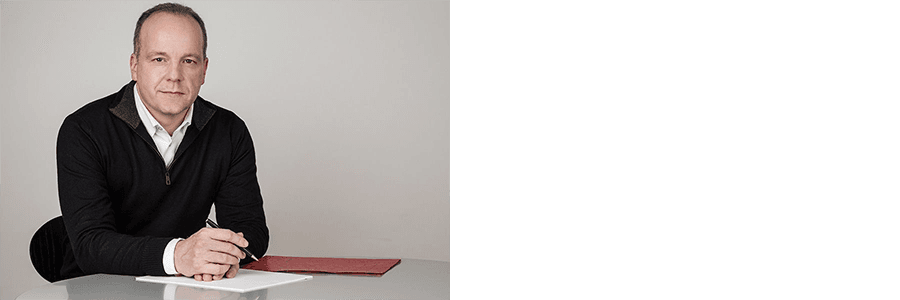
Marktkommentar von Andreas Görler, sen. Wealth Manager und zert. Fachmann für nachhaltige Investments, Pruschke & Kalm GmbH – Wellinvest –, Berlin.

Alle Gesellschaften der BTS Finance Group auf der Erfolgsspur